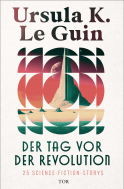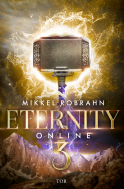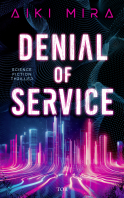
Die Glitchy Stadt. Zwischen Störung, Widerstand und posthumaner Fürsorge

Aiki Mira, 30.10.2025
In diesem Beitrag untersucht Aiki Mira die Stadt als spekulativen Möglichkeitsraum und fragt sich: Wie werden zukünftige Städte zu Interfaces des Widerstands gegen Tech-Regime und Corporate Kolonialismus und für posthumane Fürsorge.
Die Stadt als Tragetasche
Hamburg, Berlin oder Frankfurt am Main, meine Geschichten erzählen gern von konkreten Orten. Orte, die etwas mit mir zu tun haben und etwas mit mir tun. Denn Städte sind für mich nie bloß Kulisse. Ursula K. Le Guins Tragetaschentheorie der Fiktion (The carrier bag theory of fiction) fordert dazu auf, Erzählungen nicht als Speere zu denken, die geradlinig auf Konflikt und Triumph zielen, sondern als Beutel, die Dinge sammeln und zusammenhalten. So stelle ich mir auch Städte vor: als Beutel, die uns zusammenbringen und miteinander in Beziehung setzen.
Im Roman Denial of Service ist das ein kleiner Imbiss am Rande eines Bankenviertels. Pilzgeruch würzt die warmdampfende Luft. Büroangestellte, Obdachlose und Roboter treffen aufeinander. In einer vollautomatisierten Stadt gibt es hier handgefertigtes Essen. Wie ein Beutel bringt die Snack-Bar zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört.
Von Städten zu schreiben, ermöglicht mir im Sinne von Ursula K. Le Guin Geschichten zu erzählen, die von den vielen Verbindungen berichten, die unser Leben prägen. Wie eine Tragetasche bieten Städte immer zugleich Raum und halten aktiv zusammen.
Doch was passiert, wenn diese Tragetasche aus einem lebendigen posthumanen Gewebe besteht, das sich verändert, das nicht neutral ist und alles, was in ihm lebt mitbestimmt?
Die KI-gesteuerte Stadt
Denial of Service erzählt von einer neuen Stadtform, die durch die Logik des Kapitals im Zeitalter des Anthropozäns geprägt ist: von einer Tech-Milliardärin konzipiert und durch ein KI-System gesteuert. Das Frankfurt am Main der Zukunft ist dadurch zugleich hyperkapitalistisch und supersmart. Eine Stadt, die nicht nur Raum kontrolliert, sondern antwortet mit ihren eigenen Texten. Der Newsfeed der Stadt spekuliert dabei auch über mögliche Zukünfte:
Es könnten noch so viel mehr Arten hier leben, im Zentrum, in den Supertürmen oder am Fluss und in den militärischen Schutzbereichen. Diese Stadt könnte ein Artenvielfaltsgebiet sein.
Denial of Service, S.235
Das zentrale künstliche neuronale Netzwerk überwacht und optimiert; spekuliert und fabuliert. So wird die Stadt zur aktiven Struktur, die sich verwandelt und mitgestaltet, was in ihr lebt.
Die Privatstadt
Die Vorstellung von Stadt als lebendiges Gewebe verstehe ich als konkreten Gegenentwurf zu der kapitalistischen Vision einer Privatstadt. In Privatstädten soll von der Infrastruktur, bis zu Sicherheit und Gesetzgebung alles privatisiert werden. Solche Vorhaben verkaufen sich als Zukunft. Tatsächlich sind sie hyperkapitalistisch: Private Unternehmen übernehmen nicht nur öffentliche Aufgaben, sondern entwerfen auch ihren eigenen Rechtsrahmen ohne demokratische Teilhabe. So galten in der Privatstadt Próspera andere Arbeitsgesetze als im restlichen Honduras, auch Gewerkschaften waren kaum zugelassen. Wie in einer kolonialen Enklave entstand dadurch eine neue Zwei-Klassen-Gesellschaft. Frei von Demokratie funktionieren solche Privatstädte auch als eine neue Form von Corporate Kolonialismus. Das Frankfurt am Main in Denial of Service ist die erste Privatstadt Deutschlands, zugleich aber auch eine glitchy Stadt.
Die Glitchy Stadt
Ein Teenager stirbt in einem Imbiss und die Stadt reagiert nicht. Ein Glitch? In dieser Stadt gibt es noch andere Störungen: Obdachlose Kids, die für ein illegales Netzwerk arbeiten, die Drohnen umbauen, um Wolkenkratzer mit Graffiti zu überziehen. Chaos-KIs, nicht-optimierte, nicht-effiziente, affektive Algorithmen, die unkontrolliert umherziehen und sich zu neuen Netzwerken zusammenschließen. Diese Störungen ermöglichen Beziehungen, die nicht linear, nicht hierarchisch, nicht kapitalistisch sind, sondern glitchy, relational und spekulativ.
In Glitch Feminismus. Ein Manifest eignet sich Legacy Russell den Glitch (technischer Begriff für Fehler, Störung) als queer*feministische Strategie an, als performativen Bruch mit normativen Körperbildern und digitalen Kontrollsystemen. Übertragen auf Städte bedeutet das für mich: posthumane Netzwerke aus Menschen, Tieren, Maschinen, Pflanzen können die Stadt umcodieren. Gemeinsam mit diesen neu entstehenden Kollektiven erkundet der Roman wie dann selbst eine KI-gesteuerte Privatstadt, die von Algorithmen und Kapital regiert wird, zu einem Ort des Widerstands werden kann.
Queere Urbanität
Das Glitch-Prinzip von Legacy Russell wird im Roman zur urbanen Strategie. Das bedeutet zum Beispiel, zu zeigen, wie die entstehenden Kollektive Räume und Orte für alternative Familienformen schaffen, für fluides Begehren, nicht-lineare Zeitlichkeiten und posthumane Fürsorge. Räume, die Sichtbarkeiten, aber auch Irritationen erzeugen, durch das Nicht-Passen, das »Anders-Sein«. Queere Räume. Räume, an denen Emotionen, Beziehungen im Zentrum stehen, nicht Produktion, Ordnung oder Kontrolle. Orte, wie zum Beispiel das Mainufer, an dem im Roman Körper, Kunst und Zugehörigkeiten neu verhandelt werden. Unter queerer Urbanität verstehe ich also nicht einfach neue Architektur, sondern neue Formen des Zusammenkommens, der Beziehung und der Sichtbarkeit. Neue Praktiken der Störung, der Imagination und der Fürsorge.
Denial of Service
Der Titel Denial of Service (DoS) stammt aus der Informatik: Ein Angriff, der ein System durch Überlastung lahmlegt. Als Metapher steht er für Verweigerung der Teilnahme am privatisierten Tech-Regime. In einer glitchy Stadt bedeutet ein Denial of Service: Wir sind da, aber nicht so, wie ihr uns haben wollt. Ein anarchistisches Botnetz wächst, wird sichtbar durch das Nicht-Passen. Und eine neue Bewegung bildet sich, um einen menschlichen Teenager, der Maschinen, Tiere und Landschaft zusammenbringt, auch durch das Erzählen neuer Geschichten:
... wir brauchen keinen besseren Gott, wir brauchen eine bessere Geschichte. Darüber, wie wir die harten Zeiten überleben können, ohne jemanden zurückzulassen (…) Lasst mich euch vom Bleiben in der unruhigen irdischen Realität erzählen, in die wir verstrickt und an die wir gebunden sind.
Denial of Service, S.190
Posthumane Fürsorge
Widerstand wird als Bewegungen des Kümmerns erzählt, die kollektiv und glitchy sind. Denn digitale Infrastrukturen sind nicht nur als Kontrollinstrumente vorstellbar. Im Roman entstehen aus KI-Netzwerken neue künstlerische, queere und posthumane Kollektive, die Menschen und Nicht-Menschen miteinander in Beziehung setzen. Das ermöglicht neue Narrativen zu finden für Anarchie, Störung und Fürsorge. Auch wenn die Ausgangsbedingungen herausfordernd sind, stellen sich die Figuren dem Trouble und machen sich im Sinne von Donna J. Haraway verwandt mit der Stadt und untereinander.
Jetzt sind sie alle drei im Wasser gestrandet. Eine Insel für sich. Der Hund bellt und wird erst durch Tads ruhige Hand, die sein haarähnliches Fell streichelt, zum Schweigen gebracht. Zuzie greift Tads Unterarm, stützt ihn. Die ganze Welt bildet sich um sie drei herum.
Denial of Service S. 228-229
So entsteht immer wieder neu gegenseitige, posthumane Fürsorge. Zugleich passiert eine Verschiebung weg von der zentralen Stellung des Menschen. Der Mensch ist nicht mehr das Maß aller Dinge, sondern Teil eines komplexen, relationalen Systems aus unendlichen Beziehungen und anderen Formen des Kümmerns.
Fazit: Lebendige Störungen
Städte sind nie nur Infrastruktur, sondern immer auch Erzählungen. Wie erzählen wir Städte und wer kommt in diesen Erzählungen vor? Die Herausforderung ist meiner Meinung nicht, wie Städte in Zukunft optimiert werden können, sondern wie sie zu Orten werden, an denen viele Zukünfte wachsen. Orte, die glitchen dürfen, die nicht perfekt sind aber möglich. Eine glitchy Stadt lebt, weil sie stört, weil sie irritiert, öffnet, verwandelt, weil sie wie ein Beutel sammelt, was nicht zusammenpasst und trotzdem trägt.
Literatur
Haraway, Donna J. (2016): Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham, North Carolina: Duke University Press.
Le Guin, Ursula K. (2019): The Carrier Bag Theory of Fiction. London: Ignota Books.
Mira, Aiki (2025): Denial of Service. Frankfurt am Main: Fischer Tor Verlag.
Russell, Legacy (2021): Glitch Feminismus. Ein Manifest. Leipzig: Merve Verlag.