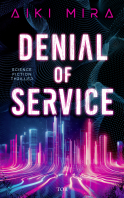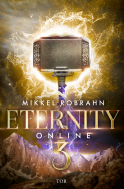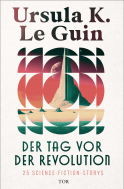
»Ich gehe jetzt« Lesen als queere Praxis - Warum Lesen heute radikaler ist als Schreiben

Aiki Mira, 27.11.2025
Aiki Mira liest die Story »Sie entnamt sie« von Ursula K. Le Guin als Einladung: Wer Namen zurückgibt, muss neu sprechen, neu denken, neu werden. In einer Zeit, in der KI-Systeme Texte in Sekunden generieren und zusammenfassen, wird das langsame, körperliche, transformative Lesen von Le Guins Science-Fiction-Kurzgeschichte zu einem Akt des Widerstands. Warum Lesen heute radikaler ist als Schreiben und was queeres Lesen mit utopischem Begehren zu tun hat.
Meine Augen brennen, sind müde vom Bildschirm, vom Scrollen, vom ständigen Wechsel zwischen Tabs. Wenn ich den Story-Band »Der Tag vor der Revolution« von Ursula K. Le Guin aufschlage, wenn meine Finger über das Papier gleiten, geschieht etwas anderes. Mein Körper spürt das Gewicht von 782 Seiten, von den vielen darin eingeschlossenen Welten. Eine Verlangsamung. Ein Ankommen im Text, das Zeit braucht.
In der Ära der Text-Generierung, in der mehr geschrieben und veröffentlicht wird als je zuvor, erscheint mir das Lesen mit einem Mal radikaler als das Schreiben. Denn, wenn immer mehr Texte von KI generiert werden und immer weniger sie wahrnehmen, wird das langsame, das transformative Lesen mehr und mehr zu einer spezifisch menschlichen, zu einer widerständigen, zu einer queeren Praxis.
Namen verschwinden: Le Guins Experiment
Ursula K. Le Guins Kurzgeschichte »Sie entnamt sie« (1985) aus dem Story-Band »Der Tag vor der Revolution« beginnt mit einer scheinbar einfachen Prämisse: Die Erzählerin nimmt alle Namen und Gattungsbezeichnungen der Tiere zurück. Sie entnamt sie.
Am Ende auch sich selbst:
»Tatsächlich wurde mir erst in diesem Augenblick klar, wie schwer es mir gefallen wäre, mein Verhalten zu erklären.« (Le Guin 2025, S.194).
Die Erzählerin kann, als Folge der Ent-Namung, nicht mehr »drauflos plappern wie früher«. Ihre Worte müssen »jetzt so langsam, so neu, so einzeln, so tastend sein wie die Schritte« mit denen sie sich von zu Hause entfernt (Le Guin, 2025, S.194).
Namen werden zurückgegeben. Erst die der Tiere: Katzen, die leugnen »jemals einen Namen außer den selbstgegebenen, unaussprechlichen und unausgesprochenen Eigennamen« gehabt zu haben (Le Guin,2025, S.192). Dann die Insekten, die »sich von ihren Namen in großen Wolken und Schwärmen« trennen »aus denen leise die Silben entsummten und brummten, entschwirrten und pieksten, entkrabbelten und sich ins Erdreich wühlten« (Le Guin, 2025, S.192).
Schließlich gibt die Erzählerin auch ihren eigenen Namen zurück. Der Text enthält weder das Wort »Mann« noch das Wort »Frau«.
Das Zurückgeben von Genderkategorien bedeutet in Le Guins Geschichte zugleich ein Verschwinden patriarchaler Verpflichtungen. Keinen Namen mehr zu haben, befreit die Erzählerin davon, für »ihn« zu kochen, ihm zu dienen. Sie kann gehen. Sie geht.
Am Ende der Geschichte steht dieser Aufbruch: »Ich gehe jetzt« (Le Guin, 2025, S.193).
Wohin? Le Guin lässt die Frage offen, und genau darin liegt die Zukunft, das noch nicht Ausgesprochene. Die Geschichte verlangt meine aktive Beteiligung. Ich muss selbst neue Zukünfte entwerfen, das offene Ende mit meinen eigenen Utopien füllen. Le Guin gibt mir einen Hinweis: Ent-Namen bedeutet, dass ich nicht mehr auf fertige Kategorien zurückgreifen kann. Ich kann neu denken, neu fühlen, neu werden.
1985 mit 2025 lesen
Queeres Lesen ist eine Methode, Texte aus einer Perspektive zu betrachten, die gängige Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität kritisch hinterfragt. Sie macht verborgene Bedeutungen und marginalisierte Stimmen sichtbar, betont die Fluidität von Identitäten und Körpern und zeigt, wie gesellschaftliche Normen konstruiert und aufgebrochen werden. Und sie kann auf alle Arten von Texten angewendet werden.
Le Guins Story stammt aus dem Jahr 1985: Zweite Feminismuswelle. Nonbinarität ist noch kein öffentlicher Diskurs. Trans* Identitäten pathologisiert. Queerness Widerstand im Untergrund. Aus heutiger queer-feministischer Perspektive lese ich »Sie entnamt sie« als unvollendetes Projekt. Und genau das macht den Text so produktiv.
Was wäre, wenn in Le Guins Gedankenexperiment nicht nur »Mann« und »Frau« verschwinden, sondern alle Pronomen? Wenn das Ent-Namen radikaler würde, als Le Guin es sich 1985 vorstellen konnte? Die Geschichte lädt mich ein, sie weiterzuschreiben im Akt des Lesens selbst. Queeres Lesen als eine Form der Beziehung zwischen Text und Leser*in ist nie neutral, nie passiv. Ich bringe meinen Körper, meine Erfahrungen und Sehnsüchte in den Text ein. Zugleich erkenne ich an, dass Texte nie wirklich abgeschlossen sind, dass ihre Bedeutung in der Begegnung entsteht, dadurch verändert wird. Lebt.
Wenn ich Le Guin heute lese, schreibt mein lesender Körper in den Text, was dort nicht steht: die Möglichkeit zu ent-Gendern, die Freiheit von binären Zwängen, die Utopie einer Welt, in der mein Körper nicht mehr durch Namen, Geschlecht oder anderen Zuschreibungen festgeschrieben wird.
Ich lese die Story auch vor Le Guins großem Roman: »Die linke Hand der Dunkelheit« (1969). Dort entwirft sie eine Welt, in der Menschen ambisexuell sind, in der Gender fluide ist, in der die Fixierung auf »männlich« oder »weiblich« als fremdartig, als beschränkend erscheint. In »Sie entnamt sie« führt Le Guin diesen Gedanken weiter: Was wäre, wenn nicht nur Gender, sondern Benennung selbst zurückgegeben wird?
Wer darf ent-nennen?
In patriarchalen, kolonialen, kapitalistischen Systemen bedeutet Benennen immer auch Unterwerfen. »Deadnaming« als das gewaltsame Festhalten am abgelegten Namen von trans* Personen zeigt, wie sehr Namen Machtinstrumente sind. Die koloniale Geschichte ist voll von der gewaltsamen Auslöschung indigener Namen für Orte, Pflanzen, Menschen. Le Guins Tiere wissen das: Sie geben sich selbst ihre Namen, verweigern teilweise ihre menschliche Benennung.
Audre Lorde (1983), die sich selbst als »Schwarze, lesbische, feministische, sozialistische Dichterin und Mutter« bezeichnete, wusste, wie wichtig Namen sein können. Für Menschen, deren Namen kolonial ausgelöscht wurden, ist Benennung ein Akt der Selbstbehauptung, des Widerstands. bell hooks schrieb über die Notwendigkeit, marginalisierte Identitäten zu benennen, sichtbar zu machen, zu behaupten. »Black woman« ist keine Kategorie, die nur einengt, sondern auch eine, die Widerstand ermöglicht, Solidarität schafft, Geschichte trägt.
Die Frage ist also nicht: Sollen wir Ent-Namen? Sondern: Wer kann sich leisten, auf Namen zu verzichten? Und was käme nach der Benennung?
Le Guins Geschichte ist eine Utopie. Utopien sind Sehnsuchtsräume, keine Handlungsanweisungen. Ich kann nicht einfach aufhören, mich zu benennen, solange die Gesellschaft auf Kategorisierung, Hierarchisierung, Ausschluss basiert. Aber ich kann mir vorstellen, was es bedeuten könnte, wenn ich es täte.
Le Guin behält die Pronomen »sie« und »er«: Ist das ein Kompromiss oder will sie mir die Arbeit überlassen, diese Auflösung selbst zu denken? Der Text ermöglicht mir beim Lesen eigene Antworten zu suchen, eigene Utopien zu spinnen.
Mein Körper liest mit
Lesen ist und bleibt zentral für mein Schreiben. Es ermöglicht mir Erfahrungen. Es gibt mir Trost. Es öffnet immer wieder meinen Blick. Science Fiction zu lesen bedeutet: mich auf Welten einzulassen, die nicht die meinen sind, auf Logiken, die mir fremd sind, auf Sprachen, die erst entstehen.
Wenn Le Guin schreibt, dass die Worte »so langsam, so neu, so einzeln, so tastend« (Le Guin, 2025, S.194) sein müssen, gibt sie mir nicht nur eine Beschreibung der Welt in ihrer Geschichte, sie gibt mir eine Anweisung für das Lesen selbst.
Virginia Woolf verstand das bereits 1926 in ihrem Essay »On Being Ill«. Krankheit, schrieb sie, ermöglicht eine andere Art des Lesens: »In der Krankheit […] verströmen Worte ihren Duft und kräuseln sich wie Blätter und überraschen uns mit Licht und Schatten.« (eigene Übersetzung, Woolf, 1926, S.41). Ein verlangsamter, kranker Körper entdeckt im Text vielleicht, was der produktive, effiziente, gesunde Körper übersieht. Le Guin schrieb in ihrem Essay »Old Body, Not Writing« darüber, wie ihr alternder Körper ihr Schreiben veränderte.
Lesen erscheint mir genauso körperlich wie das Schreiben zu sein. Ich lese Le Guins »Sie entnamt sie« mit meinem gesamten Körper, nicht nur mit meinem Kopf. Ich lese mit meinen Narben, Schmerzen, Sehnsüchten. Und das verändert, was ein Text mir sagt. Ich lese mit einem Körper, der weiß, dass er sterblich ist, dass Zeit begrenzt ist. Ich lese mit all den Erfahrungen, die mein Körper bereits mit anderen Texten gemacht hat.
Über das Hier und Jetzt hinaus
José Esteban Muñoz schrieb in »Cruising Utopia« (2009), dass Queer zu sein beinhaltet im Widerstand zur Gegenwart zu sein, was auch das Spekulieren über die Gegenwart hinaus ermöglicht, nämlich sich über das Hier und Jetzt hinaus zu bewegen, hin zu einer möglichen Zukunft mit anderen Lebensweisen. Wie Muñoz schreibt, kann Queerness »andere Arten des Seins in der Welt und damit auch neue Welten« hervorbringen (Muñoz 2009, S. 1, eigene Übersetzung). So gesehen stellt Queerness eine Form von Science Fiction dar: etwas, das noch nicht da ist, aber werden kann. Genau wie eine Utopie ist Queerness kein fertiger Ort, den wir erreichen. Beides sind Prozesse, Bewegungen, Begehren. Science Fiction ist das literarische Genre dieser Sehnsüchte.
Wenn Le Guin ihre Erzählerin am Ende sagen lässt »Ich gehe jetzt«, wenn sie mir nicht verrät, wohin, dann fordert sie mich auf, die utopische Erfahrung selbst zu machen. Mein Körper versucht sich dann vorzustellen, was es bedeuten könnte, in einer Welt ohne Namen zu leben oder ohne Genderkategorien oder ohne die Hierarchien, die Benennung immer mit sich bringt.
Das ist harte Arbeit.
Zu lesen bedeutet für mich also auch: mein Körper arbeitet am Text mit, bringt die eigenen Erfahrungen und das eigene Begehren in den Text ein, und erschafft dadurch etwas Neues, etwas, das weder ganz im Text noch ganz in mir selbst liegt, sondern erst in unserer gemeinsamen Begegnung entsteht.
Wenn ich Kreativität nicht mehr vorrangig als Produktion, sondern als Transformation verstehe, dann erscheint mir das Lesen gerade jetzt im Zeitalter der KI-generierten Texte radikaler, widerständiger und kreativer als je zuvor.
Texte leben weiter
Wieder-Lesen ist mehr als Nostalgie. Es ist ein Akt kritischer Auseinandersetzung. Ich lese Le Guin 1985 mit den Augen von 2025, mit einem Bewusstsein für trans* und nichtbinäre Identitäten. Ich sehe, wo sie visionär war und wo sie nicht weit genug ging. Le Guins Text lebt weiter, weil ich ihn lese und weiterdenke. Weil ich ihn mit den heutigen Kämpfen, Sehnsüchten, Utopien verbinde.
Science Fiction aus der Vergangenheit befremdet und bewegt meine Gegenwart. Sie zeigt, was bereits erreicht wurde und was noch fehlt.
Nach Le Guin: Andere Sprachen
Zeitgenössische Science-Fiction-Autor*innen führen weiter, was Le Guin begonnen hat. So verwendet Anne Leckie in der Trilogie »Die Maschinen« (2013-2017) ausschließlich das Pronomen »sie« und ermöglicht mir dadurch die Erfahrung einer post-binären Welt. Die Figur Breq vereint Schiff, Kollektiv und Individuum. Breq verkörpert zugleich das Raumschiff Justice of Toren, eine Einheit von Ancillarys und ein einzelnes Segment. Nach dem Ende der Kolonialherrschaft gelten Ancillarys weiterhin als geschlechtslose Stellvertreter ohne Identität. Der Text nutzt konsequent »sie« und macht Breq transhuman und transgender. Dieses »sie« bleibt ambivalent, geprägt vom ursprünglichen »es«, denn das koloniale Gendering lässt sich nicht vollständig auflösen. Diese Welt und diese Figur haben mich beim Lesen derart fasziniert, dass ich mich zwang noch langsamer zu lesen, Pausen einzulegen, um die Erfahrung auszudehnen. Mein Körper verlangt nach diesen neuen und anderen Sprachen, nach einer neuen Poetik.
Aber auch »sie« bleibt eine Kategorie, eine Benennung. Was käme danach?
Le Guin gibt mir in »Sie entnamt sie« keine Antwort. Ihr Text ermöglicht mir die Irritation, das Tasten, die Verlangsamung neuer Worte. Und gibt mir die Aufgabe, selbst eine Sprache zu erfinden, selbst zu denken, was Ent-Namen bedeuten könnte.
Begegnungen
Ich richte mich auf den Text aus, lasse mich von ihm ausrichten, verändere meine Position in Beziehung zu ihm. Queer-Lesen erkennt an, dass diese Beziehung nicht neutral ist. Ich bringe meine eigene Queerness und meinen eigenen Körper in den Text ein. Und der Text fordert mich im besten Fall heraus, mich anders zu orientieren, mich neu auszurichten, die Welt anders zu sehen, mitzugehen:
»Meine Worte mussten jetzt so langsam, so neu, so einzeln, so tastend sein, wie die Schritte, mit denen ich mich den Weg hinunter vom Haus entfernte, inmitten der hohen, dunkel verzweigten Tänzer, reglos vor dem Winterhell.« (Le Guin 2025, S.194)
Dieser poetische letzte Satz am Ende von Le Guins Geschichte ist eine Einladung, mitzugehen ins Neue, in das noch nicht Existierende. In die Zukunft.
Verwandlung statt Information
Eine KI könnte mir in Sekunden sagen: »Die Geschichte handelt von einer Frau in einer Welt, in der die Namen allmählich verschwinden. Am Ende verlässt die Protagonistin ihren Partner«.
Das ist jedoch keine Erfahrung. Das ermöglicht meinem Körper nicht die Verlangsamung, das Tasten, die Irritation. Das ermöglicht mir nicht dieses seltsame Gefühl, wenn »Mann« und »Frau« im Text nie explizit ausgesprochen werden, aber die Pronomen bleiben.
Eine Zusammenfassung verwehrt mir die Erfahrung des letzten Satzes, die Poetik von Le Guins Sprache. Eine Zusammenfassung verwandelt mich nicht, hallt nicht im Körper nach, infiziert mich nicht mit diesem utopischen Begehren.
In einer Zeit, in der das Schreiben immer mehr automatisiert werden kann, wird das Lesen zur spezifisch menschlichen Praxis. Nicht weil Menschen besser lesen als Maschinen. Maschinen können Texte schneller verarbeiten, mehr Informationen extrahieren, präzisere Zusammenfassungen erstellen. Sondern weil Menschen durch und mit ihren Körpern und ihren Erfahrungen lesen, sich dadurch wiederholt verwandeln. Das transformative Lesen als eine menschliche Arbeit.
Das Privileg der Langsamkeit
Lesen ist ein Privileg. Nicht alle haben Zeit dafür. Nicht alle können sich leisten, langsam zu lesen, sich in Science-Fiction-Welten zu verlieren, über das Ent-Namen nachzudenken. Wer arbeitet in mehreren Jobs gleichzeitig? Wer leistet unbezahlte Care-Arbeit? Wer hat am Ende des Tages noch die Energie, ein Buch aufzuschlagen?
Die größere Utopie ist vielleicht, dass unsere Körper die Zeit, die Ruhe, die Ressourcen bekommen, um zu lesen und um sich zu verwandeln. Immer wieder. Dass Lesen nicht das Privileg einer Klasse bleibt, die sich leisten kann, langsam zu sein.
Viele Zukünfte
Le Guins »Sie entnamt sie« ist für mich keine abgeschlossene Geschichte. Sie ist eine Einladung, ein Anfang, ein Tasten in Richtung einer Zukunft, die noch nicht existiert.
»Ich gehe jetzt« zu lesen und mitzugehen, ohne zu wissen wohin, weil bereits die Bewegung das utopische Moment ist.
Die Verwandlung, das Werden, die Verweigerung, festgeschrieben zu bleiben.
Meine Augen sind müde, aber ich lese weiter. Worte brauchen Zeit, um anzukommen, um sich zu entfalten, um mich zu verändern. In einer Gegenwart, in der alles schneller, effizienter, produktiver werden soll, beharrt mein Körper darauf, langsam zu lesen, viele Zukünfte zu lesen. Immer weiter-zu-lesen. Immer wieder anders-zu-werden.
Quellenverzeichnis
hooks, bell (2015): Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics. New York & London: Routledge.
Leckie, Ann. 2013-2017: Die Maschinen. Trilogie besteht aus: Die Maschinen. Die Mission. Das Imperium. München: Heyne.
Le Guin, Ursula [1969] (2014): Die linke Hand der Dunkelheit. München: Heyne.
Le Guin, Ursula K. (2025): »Sie entnamt sie«. In: Ursula K. Le Guin (2025): Der Tag vor der Revolution. 25 Science-Fiction-Storys. Frankfurt am Main: Fischer Tor. S.191.194.
Le Guin, Ursula K. (2018):»Old Body, Not Writing«. In: Dreams must explain themselves and other essays. Gollancz, London. S. 304-308.
Lorde, Audre (1983):»There is not hierarchy of oppressions«. In: Homophobia and Education. New York: Council on Interracial Books for Children. Online [letzter Zugriff am 13.11.2025]: https://uuliveoak.org/pdfs/worship_9-04-09_excerpts_no_hierarchy_of_oppressions.pdf
Lorde, Audre (2020). The Cancer Journals. Penguin Classics, London.
Muñoz, José Esteban (2009): Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press.
Woolf, Virginia (1926): »On Being Ill«. In: The New Criterion.S.32-4. Online [letzter Zugriff am 13.11.2025]: https://thenewcriterion1926.files.wordpress.com/2014/12/woolf-on-being-ill.pdf
Dieser Essay entstand aus der Begegnung zwischen einem lesenden Körper und einem poetischen Text. Er ist selbst ein Akt des tastenden Weitergehens, des utopischen Denkens. Er ist unvollendet, weil Utopien immer unvollendet bleiben müssen. Er lädt ein zum Weiterlesen, Weiterdenken, Weitergehen.