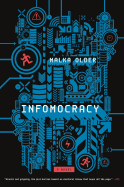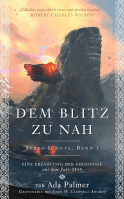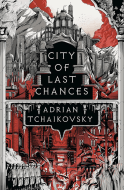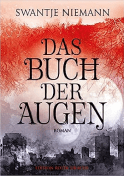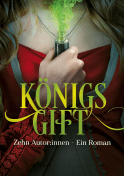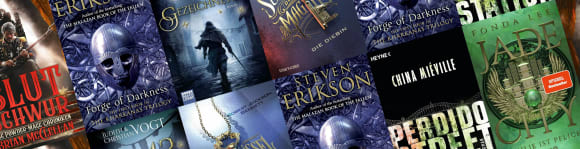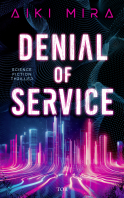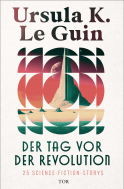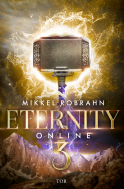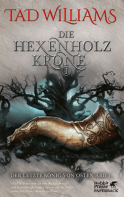
Wenn Fantasy-Figuren Politik machen

Swantje Niemann, 20.11.2025
Wie viel Politik steckt in der Fantasy? In welcher Form kann sie dort auftreten? Welche Möglichkeiten bietet sie, unsere eigene Welt besser zu verstehen? Und was hat das mit Aragorns Steuergesetzen zu tun? Swantje Niemann klärt uns auf.
Manche Beschreibungen werden für so viele Fantasyromane verwendet, dass sie nahezu nutzlos geworden sind. Zum Beispiel ignoriere ich mittlerweile “dark”/”düster” in Buchbeschreibungen, weil es so ziemlich alles von Horrorelementen über Grimdark bis ein bisschen rein dekorativer Gothic-Ästhetik bedeuten kann. Ein anderer Begriff ist ähnlich schwammig, weckt aber mein Interesse, näher hinzusehen: „politische Fantasy“. Die Bezeichnung schwirrt gelegentlich durch Diskussionen im Internet und kann, meiner Erfahrung nach, drei Dinge bedeuten, die sich oft überschneiden: Fantasy und Science-Fiction, in der in irgendeiner Form Politik betrieben wird, was auch klassische Intrigen am Königshof nicht ausschließt. SFF, welche politische Strukturen und Institutionen, ihre Stärken, Schwächen sowie Handlungsspielräume von Figuren innerhalb von diesen erkundet. Oder SFF mit einer Menge mehr oder weniger impliziten Kommentaren zu realer Politik. Gerade Zweiteres weckt mein Interesse.
Macht und Politik: Thema oder Ästhetik?
Wie auch die Düsternis in „Dark Fantasy“, können Politik und politische Ämter als Thema auftauchen, mit dem eine Auseinandersetzung stattfindet, aber auch als nahezu reine Ästhetik. Teilweise kommen hier die Wurzeln des Genres in Märchen und Sagen durch, und wir freuen uns über die Rückkehr des guten Königs, ohne, um George R.R. Martins berühmtes Beispiel zu nutzen, allzu intensiv über Aragorns Steuergesetze nachzudenken*. Gerade in Büchern mit Romantik-Fokus sind mir Macht und Status häufig als reines, nicht weiter erkundetes Accessoire begegnet. Einige Romane zeichnen glamouröse, gefühlt im leeren Raum schwebende Höfe, an denen sich Bälle und Intrigen abspielen. Die Frage „Okay, aber wen und wie und mit welcher Legitimation regieren wir eigentlich?“ spielt dann nahezu keine Rolle.
Manchmal fungieren politische Ämter in der Fantasy also eher wie das halbe Königreich, mit dem der Bauernjunge am Ende des Märchens belohnt wird: ein Endpunkt für die Figurenentwicklung, ein Symbol für Erfolg, Status, Kontrolle und Luxus. Je nach Buch funktioniert das auch. Ein eher märchenhaft anmutendes Setting, das man nicht allzu wörtlich lesen sollte, mit realistischer Verwaltungsarbeit zu kreuzen, kann die angestrebte Atmosphäre ruinieren. Es gibt auch genug Fantasy, die wenig mit Politik im engeren Sinne zu tun hat, weil sie eine fokussierte, figurenzentrierte Geschichte erzählen möchte.
Aber das gilt nicht für alle Bücher. Wenn eine Geschichte im Herzen des politischen Geschehens spielt, wird sie meist dadurch gestärkt, dass sie sich tatsächlich mit Politik auseinandersetzt – und sei es nur in Form eines einzigen, exemplarischen Problems, das als Spitze eines nicht existenten Eisbergs von den Figuren gelöst oder verschlimmert wird. Wir wissen, was Menschen mit politischem Einfluss bewirken können und fragen uns entsprechend, was die Protagonisten mit ihrem machen. Es steckt viel Potenzial für gute Geschichten darin, diese Frage spannend zu beantworten. Bücher können zum Beispiel interessant aufzeigen, wo ehrgeizige Absichten und ein beeindruckender Titel auf institutionelle oder traditionelle Schranken oder eine starke Opposition prallen. Es hebt ein Buch aus der Menge heraus, wenn der politische Kontext keine reine Kulisse ist oder ausschließlich dazu da ist, den Plot zu ermöglichen, sondern auch allgemein zum Nachdenken über Politik einlädt.
*Sehr schön weitererzählt fand ich das „Rückkehr/Aufstieg des guten Königs“-Topos übrigens in „Der letzte König von Osten Ard“ von Tad Williams: Hier sehen wir den jungen Helden und seine Frau als alterndes Königspaar, das verzweifelt versucht, eine Nachfolgekrise abzuwenden, während eine alte Bedrohung zurückkehrt. Auch hier spielt das Persönliche seine sehr große Rolle, aber im letzten Band wird auch die Frage nach der grundlegenden Gestaltung des politischen Systems und was davon bewahrenswert ist, aufgeworfen.
Interesse an Institutionen statt mächtigen Individuen
Besonders Science-Fiction hat sich in den letzten Jahren darin hervorgetan, spannende politische Systeme der Zukunft zu zeichnen. Ich denke zum Beispiel an Malka Olders Mikrodemokratie im „Centenal-Cycle“, die dezentrale, nach Expertise gewichtete Basisdemokratie der Watershed-Networks in „A Half-Built Garden“ von Ruthanna Emrys oder die auf die Vermeidung stabiler Mehrheiten ausgelegten, frei wählbaren Hives und Strats in Ada Palmers „Terra Ignota“-Tetralogie. Das sind spannende, spekulative Erkundungen davon, wie sich bestimmte Kombinationen von Wertesystemen und Technologien in politische Strukturen übersetzen und was jeweils deren Stärken und Schwächen sind. Aber auch in der Fantasy stellt sich die Auseinandersetzung mit Institutionen und systemischen Faktoren neben die mit stark an Persönlichkeiten gebundener Politik.
Richard Swans „Im Namen des Wolfes“ und die Folgebände zum Beispiel sind von einem großen Interesse daran durchzogen, wie Institutionen funktionieren und wie sie scheitern. Wir begleiten die Assistentin eines reisenden Richters. Sie lernt viel über Ideen von Gerechtigkeit, über die politischen Gremien, die Legitimationsstrategien und Strukturen eines Imperiums. Über drei Bücher erfährt sie, welche Risse es darin gibt, und bekommt die Notwendigkeit und Zerbrechlichkeit von Verhaltenskodizes für Menschen in Machtpositionen vor Augen geführt.
Ken Lius „Seidenkrieger“ nimmt noch einmal stärker die Vogelperspektive ein. Hier geht es um dynastische Übergänge und ehrgeizige Reformen. Das sehr Persönliche vermischt sich mit rivalisierenden politischen Philosophien, und die Bücher nehmen auch immer wieder in den Blick, wie technischer Fortschritt politische Machtverhältnisse und soziale Entwicklungen bedingen kann. Auch Adrian Tchaikovsky nutzt in „City of Last Chances“ eine Vielfalt von Perspektiven und Ausflüge ins Erzählen aus größerer Distanz, um dem Setting und der politischen Situation gerecht zu werden. Hier vermischen sich Kolonialismus und ein breites Spektrum von Kompromiss und Widerstand mit älteren Konflikten. Wir treffen Kolonialbeamte, Kriminelle, Student*innen, Adlige, Gewerkschafter*innen: Menschen mit den verschiedensten Visionen für die Zukunft der Stadt. Hinzu kommen diejenigen, die es aus sehr privaten Gründen ins Herz der Ereignisse zieht. Sie alle formen gemeinsam eine Geschichte, die nicht vor Komplexität zurückschreckt.
In der Romantasy kann der enge Fokus auf einer Liebesgeschichte es schwerer machen, herauszuzoomen und größere Strukturen und Kontexte in den Blick zu nehmen. Doch auch hier sind spannende Dinge möglich. Die „Saint of Steel“-Bücher von T. Kingfisher zum Beispiel gehen stark auf die lokale Ebene von Politik ein. Hier lernen wir den „Temple of the White Rat“ kennen, eine Mischung aus religiöser Organisation, sozial engagierter NGO und Lobbygruppe. Sie betreibt unter der Leitung einer brillanten Bischöfin diverse offizielle und inoffizielle Aktivitäten, und gute Absichten verbinden sich hier mit einer Menge Pragmatismus. In einem Genre, wo politisches Engagement häufig entweder „Herrscher sein“ oder „um die Herrschaft kämpfen“ ist, sind Figuren, die im oder parallel zum politischen System arbeiten und lokal eifrig mitgestalten, sehr erfrischend.
Was macht gute politische Fantasy aus?
Fantasy, die Politik schreibt, strahlt am meisten, wenn die politischen Institutionen, Fragen und Konflikte organisch aus der geschilderten Welt erwachsen, aber gleichzeitig Anwendbarkeit auf unsere Welt haben. Wie lassen sich hehre Ideale in konkrete Policy übersetzen? Welche strukturellen Faktoren schränken ein, wer politisch gehört wird? Wann ist es an der Zeit, eine Tradition loszulassen, um etwas Wertvolleres zu retten? Diese Fragen haben auch in unserer Welt Resonanz. Selbst wenn die Auseinandersetzung mit Politik im Buch nicht so viele Seiten einnimmt, kann man beim Lesen oft spüren, ob sich im Hintergrund Gedanken über das Thema gemacht wurden. Wenn dies der Fall ist, fühlt sich das Buch viel authentischer an.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, politische Systeme mit vielen Akteur*innen durch das Nadelöhr eines Fantasy-Romans zu stopfen, wo bereits so viel anderes einer Erklärung bedarf, ohne dass Erläuterungen den Plot bremsen. Ich unterstelle Autor*innen also keineswegs Desinteresse, wenn sie aus Rücksicht auf Pacing und Fokus ihres Buches nicht mehr Seiten auf das politische Geschehen verwenden. Verschiedene Subgenres haben ihre eigene Balance zwischen der Erkundung des Systemischen und Individuellen. Aber es kann ein Buch unglaublich bereichern, das politische Geschehen nicht nur als Ästhetik und Stichwortgeber für individuelle Plots zu behandeln, sondern sich auf die Konflikte und spannenden Ideen, die daran hängen, einzulassen.
Die Fantastik stellt als wichtiger Teil der Popkultur ein Reservoir von emotional aufgeladenen Bildern dar, an dem sich politische Akteure für Memes, Beispiele und Symbole bedienen – mit mehr oder weniger gutem Verständnis des Quellenmaterials. Autor*innen entkommen der expliziten Auseinandersetzung mit Politik sowieso nicht. Tendenziell kommen interessantere und nuanciertere Perspektiven dabei heraus, wenn Autor*innen das im Text gleich selbst machen und den einen oder anderen Denkanstoß einstreuen.
Fantasy zu lesen und zu schreiben, die ihre politischen Themen ernst nimmt, ist immer eine Einladung zum Nachdenken und zu einer Bestandsaufnahme, was wir tatsächlich über Politik denken und wissen. Fantasy und Science-Fiction mit ihrer Tradition groß angelegter Gedankenexperimente, ihrem Potenzial für die Verfremdung realer Konflikte und einer Leser*innenschaft, die Toleranz für große Figurenensembles und lange Zeithorizonte mitbringt, haben besonders spannende Möglichkeiten, Politik zu erzählen. Warum also nicht dieses Potenzial nutzen?

Swantje Niemann
Swantje Niemann wurde 1996 in Berlin geboren. Als Leserin, aber auch als Autorin ist sie am liebsten in den verschiedenen Subgenres der Phantastik unterwegs und teilt auch gerne in Blogposts und Rezensionen ihre Eindrücke von Büchern. Sie schreibt unter anderem für das Fanzine „Phantast“. 2021 erschien ihr vierter Roman, „Das Buch der Augen“. Mehr Informationen findet ihr unter https://www.swantjeniemann.de