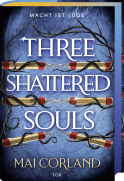Eine Reise ohne Ziel: Über Aniara von Harry Martinson

Franz Friedrich, 08.01.2026
Harry Martinsons Science-Fiction-Epos “Aniara” aus dem Jahr 1956 ist ein sehr, sehr unwahrscheinliches Stück Literatur. Und ein großartiges. Jetzt wurde es neu übersetzt und herausgegeben. Franz Friedrich stellt uns das Buch vor.
Die Erde in Harry Martinsons »Aniara« liegt im Sterben. Ihre Bewohner, die Menschen, haben sie in einem Atomkrieg derart verheert und zugrunde gerichtet, dass ihnen selbst die eisigen, kargen Tundren des Mars und die Sümpfe der Venus als lebenswerter erscheinen als ihr Heimatplanet. Und weil die Menschen zwar gelernt haben, Atome zu spalten und durch das All zu reisen, nicht aber, wie man die Erde wieder heilt, stehlen sie sich davon und nehmen Abschied für immer. Auf riesigen Raumfähren mit penibel berechneten Flugbahnen gelangen so Millionen von Exilanten zu einem neuen Zuhause. Doch auf einem dieser Schiffe – es trägt den Namen Aniara und ist Titelgeber des 1956 erschienenen Versepos – geschieht bald nach dem Start ein Unglück. Ein Meteorit zwingt zu einem Notmanöver, die Aniara wird ihrer Fähigkeit zu manövrieren beraubt, und was als eine verhältnismäßig kurze Passage mit klarer Destination gedacht war, wird zu einer Reise ohne Ziel, zu einer Hadesfahrt in die Tiefen des Alls.
»Aniara« wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, es wurde als Oper aufgeführt, als Ballett und als Musical auf die Bühne gebracht, es gibt ein Streichquartett mit diesem Namen und einen Literaturpreis, es diente als Vorlage zu einer Graphic Novel und inspirierte zu einem Gemäldezyklus. Es gilt als eines der bedeutendsten Werke Martinsons, der, wenn man der Begründung des Nobelpreiskomitees von 1974 glauben mag, vor allem für »Aniara« diese höchste aller literarischen Auszeichnungen erhielt. In Deutschland war das Werk dennoch weitgehend unbekannt; das änderte sich ein wenig, als 2019 eine Spielfilm-Adaption herauskam. Die deutsche Übertragung aus den 1960er Jahren war vergriffen, aus den Bibliotheken makuliert und höchstens hin und wieder zu Liebhaberpreisen zu bekommen. Durch das Engagement des Guggolz-Verlags ist dies nun nicht länger der Fall. Einmal mehr kommt dem Verleger Sebastian Guggolz das Verdienst zu, ein völlig zu Unrecht der Vergessenheit anheimgefallenes Werk wieder zugänglich gemacht zu haben. Aus dem Schwedischen wurde es von Lena Mareen Bruns sorgfältig neu übertragen – ein weiterer Glücksfall.
Revue über den Menschen in Zeit und Raum
Untertitelt hat Harry Martinson sein Werk als eine »Revue über den Menschen in Zeit und Raum«. Und so kreisen die Gesänge immer wieder um die Frage: Was ist der Mensch, wenn der Raum sich ins Unendliche ausdehnt und er stillzustehen scheint, wie ein Luftbläschen in einem Glas und sich doch bewegt, in rasender Geschwindigkeit – ein Lichtjahr ist ein Grab. In Aniara zeigt sich, dass die Menschen ohne die Erde eigentlich nicht sein können. Allem Fortschrittsoptimismus und Terraforming-Träumen zum Trotz bleiben sie Symbionten der Erde oder, je nach Interpretation, ihre Parasiten. Je weiter sich die Aniara von der Erde entfernt, desto verzweifelter sehnen sich die Passagiere nach ihr Heimat. Weder Orgien noch neue Religionen vermögen es, ihre Sehnsucht zu stillen; Trost spendet ihnen allenfalls eine künstliche Intelligenz. Mima, die die Erinnerungen der Menschheit in sich trägt und für die heimwehkranken Passagiere Bilder und Visionen einer besseren Vergangenheit erzeugt, gibt ihr Bestes, bis sie schließlich vor Erschöpfung zusammenbricht. Hier wiederholt sich ein Muster, das bereits auf der Erde erlernt wurde: die vollständige Ausbeutung, der Verschleiß dessen, von dem man eigentlich abhängt, bis wirklich nichts mehr geht. Die Passagiere verlieren ihren letzten Halt, der ohnehin nur eine halluzinierte Illusion war; die Verzweiflung kennt keine Grenzen – am Abgrund zur Unendlichkeit.
Mit »Aniara« ist Harry Martinson etwas gelungen, das man sich von Science Fiction oder utopischen Romanen allzu oft erhofft und doch enttäuscht wird: Hier wird die Erde verlassen, in die Zukunft gereist, und das Geschnatter der Gegenwart leiser gepegelt, um zu den wirklich interessanten Fragen vorzudringen. Dass der Text dabei nicht nur klug ist und ungewöhnlich in seiner Form, sondern auch schön – dass etwa die Erde, die gar nicht mehr Ort der Handlung ist und eigentlich als aufgegeben gilt, als etwas so Kostbares beschrieben wird – lässt seine Botschaft umso mahnender, umso dringlicher erscheinen, als jeder Appell mit erhobenem Zeigefinger es vermöge. Martinson zeigt auf sinnlicher Ebene, auf der Ebene des Details, auf, was alles auf dem Spiel steht, wenn Atommächte sich bekriegen und wenn die Klimakatastrophe weiter voranschreitet.
Nebelschleier über dem Juniwasser
In einigen der fast schon schamanistischen Beschwörungen der Erde, die in den Gesängen des Epos immer wieder angestimmt werden, meint man beim Lesen, den Duft von Walderdbeeren und Heu in der Nase zu haben, und hat den weidenflötenklaren Ruf des Kuckucks in den Ohren, meint die summenden Hummeln im Gras zu hören, sieht innerlich Nebelschleier über das Juniwasser ziehen. Der Anblick eines einzelnen kostbaren Stücks Holzes – kostbar, weil es nach der nuklearen Apokalypse keine Wälder mehr gibt, ein kleines Stück Holz, das im Schulunterricht angekokelt wird, um Kindern zu zeigen, was ein Feuer ist – löst noch Jahre später in den Erinnerungen der Reisenden Rührung aus.
Und noch etwas ist bemerkenswert an »Aniara«: Das Werk ist in beide Richtungen gelungen. Es ist gelungen als ein Text, der sich sicher im Genre der Science Fiction bewegt, wie auch in der Sphäre der Lyrik. Es ist ein Text, der technisches Wissen mit Naturbeschreibungen verbindet. Man muss sich Martinson als jemanden vorstellen, der abwechselnd in Diracs Die Prinzipien der Quantenmechanik und im Kalevala liest, der mit einem Schmetterlingskäscher und einem Teleskop über eine nächtliche Wiese geht. Falter umflattern ihn, am Himmel die Sterne.