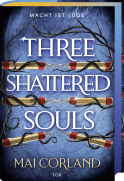Zwischen Galaxie und Golem: Jüdische Phantastik als poetologischer Modus

Franziska Thurau und Lennard Schmidt, 19.02.2026
Warum gibt es kein jüdisches Narnia?, fragte einst der Literaturwissenschaftler Michael Weingrad. Wie sieht jüdische Phantastik aus? Welche Themen behandelt sie. Das zeigen uns Franziska Thurau und Lennard Schmidt anschaulich anhand einiger Beispiele.
Einleitung
Es gibt keine jüdische Fantasy.
Mit dieser provokanten Behauptung löste der Literaturwissenschaftler Michael Weingrad 2010 in der Jewish Review of Books eine Kontroverse aus, die bis heute nachwirkt. Der Satz wirkt zunächst so offensichtlich falsch, dass man sich fragt, warum er überhaupt ernsthaft diskutiert wurde. Beweist nicht die Vielzahl jüdischer Autor:innen – von Neil Gaiman über Naomi Novik und Leigh Bardugo bis zu Michael Chabon oder Lavie Tidhar – geradezu das Gegenteil? Gab und gibt es nicht längst jüdische Fantasygeschichten in all ihren Spielarten?
Weingrad würde diese Frage verneinen. Nicht, weil er die Existenz jüdischer Schriftsteller:innen im Genre bestreitet, sondern weil für ihn eine Vielzahl jüdischer Autor:innen noch keine Fantasyliteratur begründet, die in ihrer Poetik und Weltordnung erkennbar aus jüdischen Traditionen heraus gebaut ist. Am Beispiel von Tolkien, C. S. Lewis und anderen zeigt er, dass deren Werke von klaren Heilsvorstellungen, einem kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse und eindeutig lesbaren metaphysischen Ordnungen getragen sind: literarische Variationen von Gott, Erlösung und Satan.
Für das Judentum, so Weingrads Diagnose, existiert eine solche phantastische Tradition nicht. Es gebe zwar jüdische Motive und Versatzstücke, aber keine Anderswelten, die zutiefst von jüdischer Ethik, Theologie und Normvorstellungen durchdrungen seien. Also kein jüdisches Narnia und kein jüdisches Mittelerde.
Ist damit das letzte Wort bereits gesprochen?
Weingrads Argument setzt voraus, dass Phantastik sich vor allem in kohärenten Weltmodellen und allegorisch lesbaren Heilsordnungen verwirklicht. Doch was, wenn jüdische Phantastik anders arbeitet? Wenn sie ihre Wirkung durch Umdeutung, Ambivalenz und die Arbeit an bestehenden Mythen entfaltet?
Dieser Text nimmt Weingrads Provokation ernst, kehrt jedoch die Perspektive um. Statt nach explizit jüdischen Weltallegorien zu suchen, fragt der Text, was jüdische Autor:innen tatsächlich geschrieben haben und ob sich daraus gemeinsame Denkfiguren, Motive und Erzählweisen erkennen lassen.
Zwischen Licht und Schatten: Auflösung des manichäischen Weltbilds
Wer Leigh Bardugos Shadow and Bone-Romane kennt, erinnert sich vermutlich vor allem an eine Figur: den Dunklen. Auf den ersten Blick scheint er vertraut – der mächtigste Magier der Welt, Unterdrücker ganzer Reiche, eine Gestalt, wie man sie aus zahllosen Fantasyerzählungen kennt. Doch genau diese Erwartung unterläuft Bardugo. Der Dunkle ist zugleich Retter und Unterdrücker, Schutzmacht der Grisha und ihre schlimmste Geisel. Seine Macht sichert ihr Überleben und hält sie gleichzeitig in Abhängigkeit. Man kann ihn hassen, man kann ihn verstehen, doch eines kann man nicht: ihm trauen.
Ein ähnliches Gefühl stellt sich beim Lesen von Naomi Noviks Spinning Silver ein. Miryem ist keine Heldin, die durch moralische Größe glänzt. Sie ist klug, hart, berechnend. Sie weiß, was sie tut, und sie weiß, warum sie es tut. Ihre Entscheidungen wirken unerbittlich, manchmal grausam und sind doch auf Überleben ausgerichtet. Ohne sie würde niemand überleben, weder sie selbst noch die Menschen, für die sie Verantwortung trägt. Ihre berühmte „Verwandlung“ von Silber in Gold ist deshalb kein Akt der Erlösung, sondern einer der ökonomischen Vernunft. Sie verwandelt nicht die Welt, sie maximiert ihre Handlungsspielräume. Moral zeigt sich hier nicht als Ideal, sondern als Fähigkeit, unter feindlichen Bedingungen handlungsfähig zu bleiben. In dieser Nüchternheit liegt eine Denkfigur, die sich auch aus jüdischen Traditionen heraus erklären lässt: nicht Erlösung, sondern Handlungsfähigkeit im Hier und Jetzt.
Man könnte diese Beispiele einzeln lesen und beiseitelegen. Doch nebeneinandergestellt beginnen sie sich zu ähneln. Immer wieder geht es nicht um gute oder böse Figuren, sondern um Menschen, die beides zugleich in sich tragen und zu beidem fähig sind. Ihre Handlungen lassen sich nicht eindeutig moralisch auflösen, weil sie Schutz und Gewalt, Fürsorge und Zwang miteinander verbinden. Entscheidungen entstehen nicht aus Idealen, sondern aus Druck. Moral erscheint hier nicht als Zielzustand, sondern als etwas, das unter widrigen Bedingungen nicht abstrakt behauptet, sondern konkret ausgehandelt wird.
Diese Gleichzeitigkeit von Gutem und Bösem ist in vielen jüdischen Traditionen zentral. Das Böse – oder „Satan“, sofern der Begriff überhaupt eine Rolle spielt – erscheint hier nicht als eigenständige kosmische Gegenmacht, sondern als Gott untergeordnete Instanz. Entscheidend ist deshalb nicht der kosmische Kampf, sondern der innere: das Wechselspiel von Yetzer Hatov und Yetzer Hara, guter und böser Neigung, im selben Menschen. Gut und Böse stehen sich nicht als getrennte Mächte gegenüber, sondern sind im handelnden Subjekt miteinander verschränkt. Der moralische Konflikt verläuft nicht zwischen Welten, sondern durch den Menschen hindurch.
Diese Vorstellung verbindet sich mit einer weiteren Einsicht, die in unterschiedlichen jüdischen Traditionen immer wieder auftaucht: Moral und geistige Präsenz sind nicht unabhängig von materiellen Bedingungen zu haben. Auch dort, wo das Religiöse stark mystisch gedacht wird – etwa im Chassidismus –, ist der Tzaddik nicht einfach ein weltabgewandter Asket, sondern eine Figur, die Gemeinschaft, Verantwortung und Alltag miteinander vermittelt. Schon Ex 6:9 erzählt, dass Israel Mose nicht zuhören konnte „wegen Kurzatmigkeit des Geistes und harter Arbeit“ – ein Satz, der sich als Hinweis lesen lässt, dass Überlastung und Not die Fähigkeit zur moralischen und geistigen Aufmerksamkeit real begrenzen.
Vor diesem Hintergrund erscheinen die Figuren jüdischer Phantastik nicht ambivalent im Sinne von Unentschiedenheit, sondern folgerichtig: Sie sind zugleich zu Gutem und Bösem fähig, weil beides im Menschen selbst angelegt ist.
Die Magie des Erzählens
Wenn moralisches Handeln so verstanden wird – als etwas, das unter Druck entsteht und Verantwortung einschließt, statt Reinheit zu versprechen –, dann bleibt eine Frage nicht aus: Wie wird Macht in solchen Erzählungen gedacht? Was bedeutet es, handeln zu können, wenn jede Handlung Konsequenzen trägt und niemand sich auf eine höhere Ordnung berufen kann? In der jüdischen Phantastik verschiebt sich diese Frage auffällig oft auf die Ebene der Sprache.
In Neil Gaimans The Sandman entscheidet nicht der Schwertkampf, sondern »the oldest game«: ein Duell aus Behauptung und Gegenbehauptung. Morpheus gewinnt nicht durch Gewalt seine geraubten Gegenstände aus der Hölle zurück, sondern indem er mit „Hope“ eine letzte Gegenfigur setzt, die den diskursiven Kampf sprengt. Man kann die Szene als postmoderne Pointe lesen: Das älteste Duell ist nicht das Töten, sondern das Sprechen – das Setzen von Bedeutungen, das Erfinden von Möglichkeitsräumen. Intelligenz schlägt Gewalt, weil sie die Realität, in der gehandelt wird, überhaupt erst herstellt.
Eine ähnliche Verschiebung findet sich in Matthew Kressels The King of Shards. Daniel Fisher ist kein Zauberer im klassischen Sinn, sondern ein jüdischer Softwareentwickler, der entdeckt, dass er Teil einer alten magischen Linie ist. Die Macht, die einst im gesprochenen Wort lag, kehrt im digitalen Zeitalter als Code zurück. Algorithmen übernehmen die Funktion von Zaubersprüchen, Programmiersprachen werden zu Werkzeugen der Welterschaffung. Magie ist hier eine Erweiterung menschlicher Handlungsmacht.
Was diese sehr unterschiedlichen Texte verbindet, ist eine gemeinsame Vorstellung von Macht. Sie liegt nicht in Waffen oder übernatürlicher Gewalt, sondern in der Fähigkeit, durch Sprache Wirklichkeit zu erzeugen. Worte sind Werkzeuge. Sie setzen Prozesse in Gang, die nicht rückgängig zu machen sind.
Schon in Genesis 1 entsteht die Welt nicht durch einen Akt roher Macht, sondern durch das Sprechen: „Und Gott sprach…“ – und es wird. An diese Grundfigur schließt der rabbinische Diskurs an, der das Wort nicht bloß als Mitteilung versteht, sondern als etwas, an dem Bedeutung hängt und das immer wieder ausgelegt, befragt, gewendet werden muss. Die Kabbala radikalisiert diese Sprachmetaphysik: Die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets gelten als Bausteine der Schöpfung, und das Sefer Jetzira liest die Welt als Ergebnis ihrer Kombinationen. Sprache ist hier nicht Abbild der Realität, sondern ihr Ursprung. Nicht zufällig gibt es Bräuche, Lernen mit Süße zu verbinden, so als würde man das Wort buchstäblich kosten.
Daraus ergibt sich eine theologische Konsequenz, die sich unmittelbar in der jüdischen Phantastik niederschlägt: Wer spricht, erschafft. Und wer erschafft, trägt Verantwortung. Magische Mechaniken und moralische Dilemmata lassen sich deshalb nicht trennen. Jeder Zauber, jedes gesprochene Wort und jede bewusste Entscheidung formt die Welt und zieht Folgen nach sich.
In diesem Sinne wird Magie zur Metapher menschlichen Handelns überhaupt. Macht ohne moralische Dimension ist hier ebenso undenkbar wie ein Zauberspruch ohne Worte.
Der Golem als Spiegel menschlicher Verantwortung
Wenn Worte Welten erschaffen können, stellt sich zwangsläufig eine weitere Frage: Was geschieht, wenn der Mensch selbst schöpferisch wird? Kaum eine Figur aus jüdischen Überlieferungen verbindet diese Frage so eng mit der Macht des Wortes wie der Golem. In manchen Versionen wird die aus Lehm geschaffene Gestalt durch ein Wort oder einen Namen aktiviert – oft wird dabei auf emet (אמת), „Wahrheit“, verwiesen. Entfernt man den ersten Buchstaben, das Alef, bleibt met (מת), „Tod“: Ein Zeichen weniger, und Leben kippt zurück in Staub.
In Helene Weckers Golem und Dschinn ist der Golem kein zerstörerisches Monster. Chava ist eine Frau aus Lehm, erschaffen, um zu dienen – und gerade darin zutiefst verletzlich. Sie fühlt, zweifelt, begehrt und leidet. Ihre Existenz ist von Anfang an von einem inneren Widerspruch geprägt: Sie wurde geschaffen, um zu gehorchen, und entwickelt zugleich ein eigenes Bewusstsein und den Wunsch nach Selbstbestimmung. Chava ist keine fehlgeleitete Maschine, sondern ein Wesen, das Verantwortung empfindet, ohne je darum gebeten zu haben.
Diese Darstellung steht in einer langen jüdischen Tradition. Der Golem der Prager Legende, erschaffen von Rabbi Judah Loew im späten 16. Jahrhundert, ist kein dämonisches Wesen, sondern ein Schutzgeschöpf – und gerade deshalb gefährlich. Er verkörpert die Frage, was geschieht, wenn menschliche Schöpfungsmacht ihre eigenen Grenzen überschreitet. Die Legende ist weniger eine Warnung vor Technik als eine Meditation über Verantwortung: Wer schafft, übernimmt Verantwortung für das Geschaffene, auch wenn es sich verselbständigt.
Weckers Neuinterpretation verschiebt diese Perspektive noch einmal. Indem sie dem Golem Empathie, Innerlichkeit und Leiden zuschreibt, kehrt sie ein Bild um, das in der europäischen Imagination häufig antisemitisch aufgeladen war: das des unkontrollierbaren, gefährlichen künstlichen Wesens. Der Golem wird hier nicht zur Bedrohung, sondern zum Spiegel menschlicher Hybris – und menschlicher Pflicht.
Gerade deshalb wirkt die Figur bis in die Gegenwart hinein. Debatten über Gentechnologie, künstliche Intelligenz, Robotik oder algorithmische Systeme kreisen um dieselbe Frage, die der Golem-Mythos bereits stellt: Was bedeutet es, etwas zu erschaffen, das handeln kann? Und wie weit reicht die Verantwortung des Schöpfers, wenn Kontrolle zur Illusion wird?
Der Golem ist damit keine beliebige Figur, sondern ein narrativer Eckpfeiler jüdischer Phantastik. Er verweist auf ein jüdisches Verständnis von Schöpfung, in dem der Mensch als Mit-Schöpfer (schutaf) handelt, ohne je die Rolle Gottes einzunehmen. Entscheidend ist dabei die Bindung an Sprache: Der Golem wird in vielen Überlieferungen durch ein Wort, einen Namen oder eine Inschrift belebt – und ebenso wieder stillgestellt. Dadurch ist Schöpfung weniger Erlösungsakt, sondern ein reversibler Eingriff, der Verantwortung erzeugt: für das Geschaffene, für seine Wirkung und für Konsequenzen, die sich der eigenen Kontrolle entziehen.
Zwischen den Welten: Die Diaspora als narrative Struktur
Im Golem-Mythos endet Verantwortung nicht mit der Schöpfung. Sie bleibt wirksam, offen und nicht abschließbar. Diese Unabgeschlossenheit hat eine räumliche Entsprechung: Es gibt keinen Ort, an dem Verantwortung aufgeht, keinen sicheren Raum, in dem Folgen endgültig eingeholt oder Handlungen abgeschlossen wären. Verantwortung bleibt in Bewegung.
In Die Vereinigung jiddischer Polizisten entwirft Michael Chabon eine alternative Geschichte, in der jüdische Exilant:innen in Alaska einen eigenen Staat errichtet haben. Doch dieser Staat ist von Anfang an als Übergang konzipiert. Er ist fragil, befristet und von der Gewissheit geprägt, wieder verschwinden zu können. Heimat ist hier ein Arrangement auf Widerruf.
Auch The History of Soul 2065 von Barbara Krasnoff baut einen unstofflichen Ort. Über mehr als ein Jahrhundert hinweg werden Geschichten zweier Familien miteinander verflochten. Identität entsteht nicht durch Ankunft, sondern durch Weitergabe, Erinnerung und Bewegung durch die Zeit. Die Erfahrung des Dazwischen wird zur Struktur der Erzählung selbst.
Selbst dort, wo diese Logik in die Zukunft oder in den Weltraum verlagert wird, bleibt sie erhalten. In Foundation von Isaac Asimov geht es nicht um Rückkehr oder Erlösung, sondern um das Bewahren von Wissen unter Bedingungen des Zerfalls. Eine verstreute Gemeinschaft trägt Verantwortung durch dunkle Zeiten hindurch und sorgt mit der Bewahrung von Wissen dafür, dass sie auch in Zeiten des Zerfalls handlungsmächtig bleibt.
Ähnlich verhält es sich in Star Trek. Die Föderation ist keine gottgegebene Ordnung, sondern ein mühsam ausgehandeltes Projekt. Unterschiedliche Spezies leben zusammen, ohne ihre Differenzen aufzulösen. Zukunft entsteht hier nicht durch Homogenisierung, sondern durch Übersetzung, Aushandlung und das Aushalten von Verschiedenheit. In der Figur Spock verdichtet sich diese Erfahrung: Er gehört weder ganz zu Vulkan noch ganz zur Erde. Seine Hybridität ist zunächst eine Last und wird schließlich zur Voraussetzung seiner Stärke.
Was sich in diesen Erzählungen zeigt, ist keine Sehnsucht nach Ankunft, sondern eine Erzählweise, die Bewegung, Vorläufigkeit und das Leben im Übergang ins Zentrum rückt. Orte sind hier keine Endpunkte, sondern Konstruktionen auf Zeit.
Diese räumliche Offenheit lässt sich als eine Erfahrung lesen, die jüdische Traditionen und Selbstdeutungen seit Jahrhunderten prägt: die Erfahrung der Diaspora. Der Historiker Simon Dubnow beschrieb das Judentum einst als eine „Nation ohne Territorium“, in der Zugehörigkeit nicht durch Räumlichkeit, sondern durch Erinnerung und Weitergabe entsteht. Genau diese Logik kehrt in der jüdischen Phantastik als Erzählstruktur wieder, indem es die Erfahrung des »Dazwischen« verdichtet. Jüdische Phantastik erzählt von einem Leben zwischen Welten, in dem Zugehörigkeit nie eindeutig ist: weder fremd genug, um klar außen zu stehen, noch vertraut genug, um wirklich anzukommen.
Solche Zustände lassen sich kaum als lineare Entwicklung oder abgeschlossene Geschichte erzählen und entziehen sich der Logik realistischer Prosa. Die Phantastik hingegen verfügt über eine Sprache für Übergänge, für Verwandlungen und für unmögliche Geografien. Sie kann Räume öffnen, in denen zwischen Warpantrieb und Weltraumdiplomatie Bewegung nicht überwunden, sondern bewohnt wird.
Jüdische Phantastik als Denkform
Nachdem sich zentrale Denkfiguren jüdischer Phantastik herausarbeiten lassen, stellt sich eine naheliegende Frage: Wirken diese Denkformen auch über jüdische Autorschaft hinaus? Die Literaturgeschichte legt nahe, dass Denkstrukturen nicht an religiöse oder ethnische Identität gebunden bleiben. So wie christliche Theologie die europäische Literatur tief geprägt hat, ohne dass alle ihre Autor:innen Christen waren, hat auch jüdische Mystik Spuren hinterlassen, die sich jenseits jüdischer Kontexte wiederfinden lassen.
Ein paradigmatisches Beispiel dafür liefern die Erdsee-Romane von Ursula K. Le Guin. Der junge Zauberer Ged steht dort keinem äußeren Erzfeind gegenüber. Sein größter Gegner ist ein Schatten, der aus seinen eigenen verdrängten Anteilen hervorgeht. Erlösung bedeutet hier nicht Sieg oder Vernichtung seines vermeintlichen Gegners, sondern Erkenntnis und Integration. In der entscheidenden Szene benennt Ged den Schatten mit seinem eigenen Namen und erkennt ihn als Teil seiner selbst an. Das Böse wird nicht ausgelöscht, sondern aufgenommen. Moralisches Handeln besteht nicht im Kampf gegen das Andere, sondern in einem (selbst)therapeutischen Umgang mit dem Bösen, das in jedem Menschen angelegt ist.
Noch präziser lässt sich diese Denkform in Babel-17 von Samuel R. Delany beobachten. Der Roman kreist um eine künstliche Sprache, die nicht nur Kommunikation ermöglicht, sondern Wahrnehmung und Handeln grundlegend verändert. Wer Babel-17 spricht, denkt anders – und handelt anders. Sprache beschreibt hier keine Realität, sie erzeugt sie. Entscheidungen, Gewalt und Loyalität entstehen nicht aus freiem Willen, sondern aus den Denkstrukturen, die diese Sprache vorgibt.
Gerade darin liegt die ethische Brisanz des Romans. Babel-17 ist kein neutrales Werkzeug. Sie verleiht Macht, aber diese Macht ist untrennbar mit Verantwortung verknüpft. Wer die Sprache benutzt, trägt die Folgen dessen, was sie hervorbringt – selbst dann, wenn diese Folgen nicht vollständig intendiert oder kontrolliert werden können. Schöpfung bedeutet hier nicht Erlösung, sondern Verstrickung. Worte formen Wirklichkeit, und wer sie gebraucht, greift schöpferisch in die Welt ein.
Zugleich ist Babel-17 ein Roman der Ortlosigkeit. Seine Figuren bewegen sich zwischen Fronten, Identitäten und Zugehörigkeiten, ohne je in einer stabilen Ordnung anzukommen. Gemeinschaft entsteht provisorisch, Wissen zirkuliert fragmentarisch, Orientierung bleibt vorläufig. Zugehörigkeit erscheint auch hier nicht als Zustand, sondern als Prozess – als Bewegung durch Zwischenräume.
Diese Beispiele zeigen: Jüdisch geprägte Phantastik ist nicht unbedingt eine Frage der Autorschaft, sondern der Perspektive. Ihre Denkfiguren – die Auflösung absoluter Gegensätze, die schöpferische Macht der Sprache, Verantwortung ohne Erlösungsversprechen und Zugehörigkeit ohne festen Ort – lassen sich auch dort erkennen, wo sie nicht ausdrücklich jüdisch markiert sind. Doch ihre Herkunft bleibt entscheidend. Denn erst im Rückbezug auf jüdische Theologie, Mystik und Erfahrung wird sichtbar, dass es sich hier nicht um zufällige Motive handelt, sondern um eine zusammenhängende Art, Welt zu denken und zu erzählen,
Fazit: Jüdische Phantastik als offener Raum
Michael Weingrad fragte, warum es kein jüdisches Narnia gebe. Die Antwort ist ebenso schlicht wie grundlegend: weil es ein solches nicht braucht.
Jüdische Phantastik existiert nicht als geschlossene Welt mit eindeutigen Allegorien und klaren Erlösungsordnungen. Sie existiert als literarische Praxis, die nicht nur Fluchtwelten entwirft, sondern Denk- und Erfahrungsräume schafft, in denen Zugehörigkeit ein Aushandlungsprozess ist, in denen Gut und Böse keine Gegenspieler sein müssen und in denen Verantwortung keinen Endpunkt kennt.
Gerade deshalb bleibt der Begriff ambivalent. Als Genrebezeichnung schafft er Sichtbarkeit, birgt aber auch die Gefahr der Verengung. Seine Stärke liegt genau darin, sich nicht festschreiben zu lassen.
Ein jüdisches Narnia braucht es also nicht. Was es braucht, ist eine Phantastik, die das Schwarz-Weiß-Denken hinter sich lässt – literarisch wie ethisch – und anerkennt, dass das Böse nicht vernichtet werden kann, weil es im Menschen selbst liegt. Die stärkste Magie besteht vielleicht darin, ihm beim eigenen Namen zu begegnen.

Franziska Thurau
Franziska Thurau studiert seit Oktober 2020 Klassische Archäologie und Geschichte (B.A.). Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Genese des Antisemitismus in der vorchristlichen Antike sowie den Kontinuitäten antisemitischer Narrative von der Antike bis in die Gegenwart.

Lennard Schmidt
Lennard Schmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung. Gemeinsam mit Salome Richter leitet er die Initiative als kollegiale Leitung. In seiner Dissertation untersucht er Antisemitismus in der 68er-Bewegung.