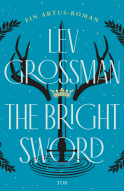The Eternaut: Von Invasionen und der Nostalgie der Boomer

Larsch Schmeink, 15.05.2025
Sie ist der Netflix-Überraschungshit der letzten Wochen: die argentinische Science-Fiction-Serie The Eternaut. Wie aus der kultigen, revolutionären Comicvorlage eine reaktionäre Serie werden konnte, und wie das alles mit der Militärdiktatur in Argentinien zusammenhängt, erklärt uns Lars Schmeink.
Alien-Invasionen gehören seit H.G. Wells‘ Krieg der Welten zum festen Programm der Science Fiction. Ob als klassische Darstellungen von imperialer Kriegsmacht, als subversiver Unterwanderung durch Fremde, die aussehen wie wir, oder als undurchsichtige Bedrohung von Oben – die Aliens werden von der SF immer wieder als Chiffre für unsere verschiedensten Ängste genutzt. So auch in der neuen Netflix-Serie The Eternaut, basierend auf einem Comic-Klassiker.
Im Comic L’Eternauta, des argentinische Autors Héctor Germán Oesterheld und seines Zeichners Francisco Solano López, kommt die Invasion ganz leise und natürlich anmutend daher: eines Abends beginnt es in Buenos Aires auf unerklärliche Weise zu schneien und jeder, der mit den Flocken in Berührung kommt, stirbt. Juan und seine Freunde sitzen in der einen Minute beim Kartenspiel zusammen und müssen in der nächsten um ihr Überleben kämpfen, gegen die ausbrechende Anarchie, aber auch gegen die Invasoren, die mit riesigen Käfern und versklavten Truppen angreifen. Der Comic legt besonderen Wert darauf, dass Juan, Flavo, und Lucas – die drei Freunde – einfache, normale Menschen sind, keine Helden. Sie kämpfen für ihre Freiheit, gegen einen übermächtigen und niemals wirklich zu erkennenden Feind. Diese Underdog-Story hat L‘Eternauta, der von 1957-59 in einem argentinischen Magazin erschien, zum berühmtesten Comic Argentiniens werden lassen. Kein Wunder also, dass Netflix den Stoff entdeckt und nun als Serie auf den Markt gebracht hat.
Was dem Comic zum Erfolg verhalf, war vor allem der Zeitgeist der späten 50er und 60er Jahre und das fast schon prophetische Moment: Zum einen erschien L’Eternauta zu einer Zeit unwägbarer politischer Unruhen in Argentinien. Der Militärputsch, der den autokratischen, aber beim Volk wegen seiner sozial-starken Politik geliebten Präsidenten Juan Péron aus dem Amt trieb, inspirierte eine linksextreme Bewegung (die Montoneros), die den ständig wechselnden und unsicheren Regierungen im Land gegenüberstand. Der Kampf des kleinen Mannes gegen das übermächtige System in L’Eternauta war also eine willkommene Botschaft auf den Straßen Buenos Aires‘.
Und zum anderen, wurde Oesterhelds Comic immer mehr eine Allegorie seines eigenen Lebens, als hätte er seine eigene Zukunft beschrieben. Als das Militär im Jahr 1976 erneut putschte und eine brutale Diktatur errichtete, ging er zusammen mit seinen vier Töchtern als Teil der Montoneros in den Untergrund. Alle fünf geraten nacheinander in die von der Diktatur errichteten Folterlager und Gefängnisse und bleiben für immer verschwunden. Eine im Untergrund geschriebene und noch politischere und kritischere Fortsetzung von L’Eternauta erscheint in dieser Zeit und zementiert den Erfolg des Comics, kostet Oesterheld aber vermutlich auch sein Leben.
Boomernauten
Der Comic ist also quasi argentinisches Nationalgut, ein Meisterwerk politischer Kritik an der Zeit des Staatsterrors und des dreckigen Krieges gegen das eigene Volk. Und darauf baut auch die Netflix-Serie auf, die versucht, das historische Erbe für ein neues Publikum greifbar zu machen. Eine tolle Idee, ist das Land doch gerade wieder in einer Krise, die Wirtschaft instabil, der Präsident ein Kettensägen-schwingender Autokrat. Doch hier wird es kompliziert. Denn der Zeitgeist des Comics, also die revolutionäre Idee linker Politik der 1960er Jahre, ist gekippt, die Revolutionäre sind reaktionär geworden. Die Kulturrevolution ist von einem Moment konservativer Boomer-Nostalgie verschlungen worden. Und so wirkt die Geschichte seltsam deplatziert und die Verfilmung ungewollt aus der Zeit gefallen.
Zum einen wären da die Helden – die Jedermänner – die so gar nicht mehr das Volk repräsentieren, weil sie alle Mitte 60 sind, weiß, wohlhabend und gebildet. Juan ist ehemaliger Soldat aus dem Falkland-Krieg (ebenfalls Nationalsymbol und Trauma zugleich) und ein grandioser Schütze und Kämpfer. Flavo ist Elektroingenieur und Bastler – er kennt sich mit alter Technik aus und kann alles reparieren, was überlebenswichtig wird, weil die Serie der 2020er das 1960er Feeling zurückholt, in dem es einen elektromagnetischen Puls alle Elektronik auslöschen lässt. Kein Handy, kein Internet, keine smarten Homes oder Autos, keine KI. Auf einmal ist wieder Mitte des 20. Jahrhunderts und die Überlebenden müssen sich auf Diesel-Generatoren, alte Funkgeräte und vor der Ölkrise gebaute Autos verlassen. Die Helden sind Helden, weil sie dank ihrer Geburt vor dem Aufkommen der Elektronik noch mit einer harten Welt umgehen können – und das nehmen sie als Argument, um alle anderen zu befehligen, über sie zu bestimmen und ihren Weg als den einzig wahren zu deklarieren.
Beispielsweise gegenüber ihren Frauen, die zwar ebenfalls privilegiert sind und ideal in die Situation passen – Juans Ex-Frau Elena ist Ärztin – aber den Entscheidungen ihrer Männer untergeordnet bleiben. Klar erkennbar ist, dass die Serie hier die Rollenbilder früherer Zeiten stärkt und den Männern durch das Storytelling recht gibt. Die Frauen übernehmen die Care-Arbeit, kümmern sich um Kinder, Kranke, und das soziale Gefüge, aber sie unterstehen der Macht der Männer. Als Elena einer schwangeren Frau Schutz gewähren will und sich gegen Juan stellt, wird diese zur Bedrohung, stiehlt lebenswichtige Medikamente und kostet Elena und Juan fast das Leben. Die Serie zementiert also die Weltsicht der Männer, die sich und die ihren verteidigen wollen und gegen Solidarität und für Selbsterhalt plädieren.
Noch deutlicher wird die Positionierung der Serie in Hinsicht auf junge Menschen – denn wie gesagt, Juan und Co. sind über 60 und deutlich als Boomer erkennbar. Sie haben einen Plan, handeln gezielt und haben das jetzt in dieser Situation notwendige Skillset: Reparaturen an mechanischen Geräten, Kriegserfahrungen, dominantes Leadership-Verhalten. Und sie haben die Mittel. Ihnen gehören die Häuser, die Autos, die alte Technik, die sie aus Nostalgie gesammelt haben. Die jungen Menschen, dargestellt durch Figuren wie den Neffen eines der Freunde, Omar, oder die Fahrradkurierin Inga, sind von der Situation überfordert. Sie treffen problematische Entscheidungen, sind impulsiv und geraten so in Gefahr oder gefährden andere. Zumindest initial werden sie als schlechte Ratgeber dargestellt und müssen lernen sich zu anzupassen.
Ein Faktor, den die Serie dabei nie thematisiert: die jungen Menschen haben keinerlei wirtschaftliche Sicherheit und dadurch eben auch keine soziale Macht. Was angesichts der aktuellen Wirtschaftslage in Argentinien sicher Sinn ergibt, aber zugleich auch das so gar nicht repräsentative Privileg der Helden Juan und Flavo unterstreicht. Die Jungen erhalten Schutz durch den Besitz der Alten, aber nur, wenn sie deren Regeln befolgen. Als Flavo die Regeln neu definiert und das Auto nicht für individuelle Bedürfnisse hergeben will, versteht Omar das als den Akt, der er ist: eine Fremdbestimmung durch die privilegierte Gruppe. Er stiehlt den Wagen und gefährdet so alle Überlebenden – ist dazu aber gezwungen, weil die Alten seine Bedürfnisse nicht anerkennen und seine Perspektive nicht mal sehen wollen.
Liest man diese Botschaft nicht aus der Sicht der 1960er Jahre (als der Comic populär war), sondern eben der 2020er, dann ist der Kampf der Boomer gegen das übermächtige System und die Rückkehr zu eigener Größe, Bedeutung, und Macht ein klares Signal: früher war alles besser. Das System, das ist die globale, digitale Welt. Die Revolution dagegen ist Abschottung, sich um die eigenen Bedürfnisse kümmern, sich selbst der nächste sein. Der Comic war ein politischer Akt gegen die Militärdiktatur. Die Serie jedoch dreht die Zeit zurück und wirkt dadurch reaktionär, ganz so wie es die vermeintlich starken Männer Donald Trump und Javier Milei wollen. Sie sieht nicht, dass in der heutigen Zeit der Jedermann nicht ein privilegierter weißer Mann mit Geld und Einfluss sein darf. Sie sieht nicht, dass die wirtschaftliche und politische Realität diesen weißen Mann zu einem Teil des Systems gemacht hat. Sie sieht nicht, dass eine L’Eternauta-Umsetzung sich um Inga – die junge Frau, die als Fahrradkurierin in der Gig-Economy zu überleben versucht, ohne Heim und Besitz – hätte drehen müssen. Sie sieht nicht, dass sie die falschen Helden und somit symbolisch den Status Quo stützt, statt eine echte Revolution zu vermitteln. Das ist schade, denn die eigentliche Botschaft von L’Eternauta ist wichtig und gut – arbeitet zusammen, wehrt euch gegen die Übermächtigen, lasst euch nicht unterkriegen. Vielleicht schaffen die Macher*innen der Serie ja den Erfolg der ersten Staffel zu nutzen, um die Botschaft der zweiten besser an die heutigen Realitäten anzupassen.