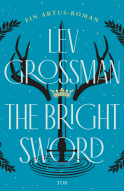
Fay Fatale – Die Geschichte von Morgan le Fay

Tabea Hawkins, 08.05.2025
Wir lieben sie zu hassen und hassen sie zu lieben, die Femme Fatale. Schon seit der Antike werden mächtige Frauen gefürchtet, sei es auf Grund von magischen Fähigkeiten, wie Medea oder Circe, oder ihrer Sexualität, mit der sie die Männer um den Verstand bringen und sich hörig machen, wie Lilith oder Eva. Morgan le Fay verbindet beide Aspekte in sich als moralisch ambivalente Verführerin und Zauberin. Tabea Hawkins gibt uns einen Einblick in die verschiedenen Darstellungen von le Fay in der Artus-Sage.
Mythologische Ursprünge
Morgan le Fay – abgeleitet aus dem Französischen Morgan die Fee–, ist eine mythische Figur aus der Artussage. Es wurde auf Grund des Namens auch schon spekuliert, ob sie sich aus der irischen Göttin Morrígan entwickelt haben könnte, der gestaltwandelnden Göttin für Kampf und Krieg, aber auch Schicksal, die in manchen Erzählungen außerdem Fruchtbarkeit oder Sexualität repräsentieren kann. Auch die walisische Muttergöttin Modron könnte in die Figur mit eingeflossen sein. Letzten Endes gibt es eine ganze Reihe an Sagenstoffen und Figuren, die in Wiedererzählungen zusammengenommen oder verändert werden. Diese Flexibilität ist es schließlich auch, was Mythen am Leben erhält. Morgan le Fay hat bis heute viele verschiedene Formen und Namen angenommen unter denen wir sie kennen. Manchmal wird sie als menschliche Frau beschrieben, die allerdings immer magische Fähigkeiten hat, manchmal ist sie eine Feenkönigin oder gar eine Göttin, aber zunächst erscheint sie als ein guter Einfluss im Leben König Artus, als eine übernatürliche Heilerin und Verwandte, die seinen Leichnam nach Avalon bringt.
Adaptionen im Mittelalter
Im Mittelalter wird die Legende um König Artus und seine Ritter der Tafelrunde in vielen Texten und Geschichten verarbeitet. Um 1150 beschreibt Geoffrey Monmouth Morgan in seiner Vita Merlini als eine der Königinnen von Avalon, die sich vor allem durch ihre Heilkunst von ihren Schwestern hervortut. Einer der bekanntesten mittelalterlichen Autoren, die sich dem Artusstoff annehmen, ist Chrétien de Troyes. In seinen Texten aus dem 12. Jahrhundert ist Morgan die Schwester des Königs und versteht sich ebenfalls auf Heilkunst. In seinen Erzählungen tauchen mal eine Salbe, mal ein Heiltrank auf, die von ihr gebraut wurden und dem ein oder anderen Ritter aus einer brenzlichen Situation helfen. Auch in den deutschen Versionen taucht sie als Heilerin auf, wie in Hartmans von Aue Erec von ungefähr 1185, als der Titelheld von Königin Guinevere mit einem magischen Pflaster geheilt wird, dass sie von der Schwester des Königs erhalten hat. Soweit, so ungefährlich, erscheint die Figur, mehr Femme als Fatal.
Erst der sogenannte Vulgata-Zyklus im 13. Jahrhundert, der vermutlich auf Grund starker religiöser Einflüsse zum einen die “heidnischen” Elemente der Legende sehr viel negativer betrachtet, als auch eine zunehmend anti-sexuelle Haltung an den Stoff heranträgt, machen Morgan zu einer intriganten und böswilligen Figur. Sie spielt die Verführerin des Königs und damit Gegnerin von Königin Guinevere und versucht auch einige der Ritter der Tafelrunde zu verführen (vor allem Lanzelot). Sie wird zu einer eifersüchtigen bösen Hexe, die ihren Sohn instrumentalisiert, um sich an ihrem Bruder zu rächen, sei es durch ihre Magie oder ihre Schönheit und Sexualität, mit der sie den Männern den Kopf verdreht.
Es gibt eine ganze Reihe an Geschichten um Morgan, von ihrer Kindheit, ihrer Lehre unter Merlin am Hofe Camelots, ihren Liebschaften, Intrigen und guten Taten. Zusammen mit ihrer Assoziation mit den Feen – oder die Fae, wie sie mittlerweile gerne genannt werden –, als ambivalente Figuren mit großem Potential für Gut und Böse, erklärt es, weshalb Morgan le Fay eine so vielschichtige und ebenso ambivalente Figur geworden ist und uns bis heute beschäftigt
Moderne Interpretation
Vor allem in modernen Interpretationen des Artusstoffs, aber auch generell in der Fantasy, taucht Morgan le Fay immer wieder auf (schließlich wird das keltische Kulturgut nur zu gerne als Vorlage fantastischer Welten und Wesen genutzt, wie zum Beispiel in Court of Thorns and Roses und Throne of Glass von Sarah J. Maas).
Aus heutiger Perspektive, mit etwas anderen moralischen Grundsätzen im Gegensatz zum Mittelalter, kann man Morgans Geschichte als die einer tragischen Figur betrachten. Uther Pendragon erschlägt ihren Vater, um mithilfe von Merlins Mächten ihre Mutter zu rauben und zu heiraten und zerstört damit ihre Welt. Morgan und ihre Schwestern sind als Überbleibsel der alten keltischen Welt herausgerissen aus ihrer Kultur und müssen sich dem Christentum fügen. Morgan wird zunächst in einen Konvent gesteckt, dann an einen Verbündeten Uthers verheiratet, herumgeschoben als politischer Spielstein. Ihre magischen Fähigkeiten und ihre Schönheit sind die einzigen Mittel, die ihr bleiben, um irgendeine Selbstbestimmung zu behalten und selbst dann ist sie darauf angewiesen, Männer dazu zu bringen, für sie zu kämpfen oder sich für sie einzusetzen.
Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite mit den verschiedenen Werken und einer Auflistung, welche Natur die Figur hat: gut, böse oder irgendwo dazwischen.
Der letzte Eintrag zur neuesten Verarbeitung der Artus-Sage ist The Bright Sword von Lev Grossman von 2024 (bzw. 2025). In der Wikipedia Tabelle bleibt die Zelle zur moralischen Natur von Morgan le Fay hier jedoch leer. So muss man selbst entscheiden, ob oder wie man ihr Handeln bewerten möchte. Etwas, dass sich aber auch über alle anderen Figuren innerhalb des Buches sagen lässt. Jeder und jede hat seine eigene Lebensgeschichte, die wir über den Lauf des Buches mitverfolgen dürfen und ein wundervoll rundes und facettenreiches Bild des mythischen Mittelalters erschafft, irgendwo zwischen Realität und Legende. Wenn man glaubt, man kennt die Geschichten bereits, dann zeigt einem The Bright Sword, dass man nur eine der Perspektiven kennt und beleuchtet, was bisher auf Camelot in Ecken und Schatten verborgen lag.

Tabea Hawkins
Tabea Hawkins liebt das Schreiben – so sehr, dass sie sich eigentlich mit nichts anderem befasst, ob als Leiterin des Schreibzentrums der LMU, beim Verfassen ihrer Dissertation über mittelalterliche deutsche Literatur oder in ihren Kursen zum kreativen Schreiben. Ihre eigenen kreativen Texte, Poesie oder Prosa bewegen sich gerne in phantastischen Welten, sei es Cyberpunk oder High-Fantasy. Jetzt neu auf der Liste: journalistisches Schreiben.





