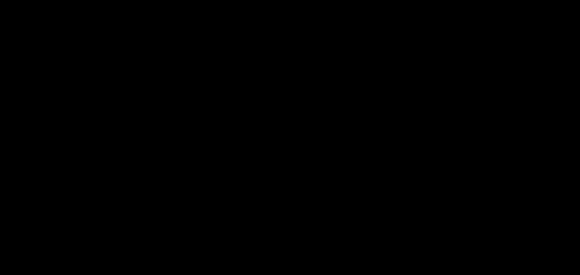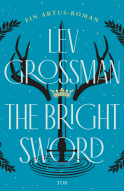
Two Bright Brains for One Bright Sword: Unsere Tandemübersetzung von Lev Grossmans neuem Artus-Roman

Alexandra Jordan und Heide Franck, 24.04.2025
Zwei Stühle, eine Übersetzung. Alexandra Jordan und Heide Franck berichten uns, wie sie mit The Bright Sword einen Artus-Roman ins Deutsche übersetzt haben, wo die Herausforderungen lagen und was besonders Spaß gemacht hat.
Morgens, halb zehn in Deutschland. Zwei Übersetzerinnen öffnen zeitgleich ihr gemeinsames Online-Gehirn. Die eine mit Ingwertee, die andere mit Kaffee, überprüfen beide noch mal das Cloud-Dokument mit Glossar, Diskussionstabelle, Quellenverweisen und Seitenaufteilung – es stehen zwei, drei intensive Telefonatsstunden an, dabei ist die letzte Diskussion im Telegram-Chat noch gar nicht so lange her. (Keine zwölf Stunden nämlich.)
Eine Übersetzung ist zwar immer irgendwie auch eine Gruppenarbeit, denn es feilen ja auch noch die Lektorin und der Korrektor daran. Aber meistens sitzt eine Übersetzerin monatelang allein an einem Text, recherchiert, formuliert, wägt ab, überdenkt, verwirft, bis der Text zur nächsten Bearbeitungsetappe geschleust wird. Wenn eine Übersetzung allerdings besonders schnell gehen muss, wenn das Manuskript besonders lang ist oder bei der Übersetzerin noch andere Projekte drängeln, wird auch schon mal ein Kollege hinzugezogen … und manchmal blickt man sich, wie in diesem Fall, nach vier Jahren intensiver Zusammenarbeit erstaunt um und stellt fest, dass man tatsächlich lieber gemeinsam arbeitet als allein. Huzzah!
Tandem mit System
Damit sich eine Übersetzung, an der zwei Gehirne gearbeitet haben, genauso flüssig liest wie eine Einzelübersetzung, haben wir beide ein für unser Tandem gut funktionierendes System entwickelt, das man am Beispiel von „The Bright Sword“ von Lev Grossman wunderbar demonstrieren kann – einem auf der Artus-Sage basierenden Roman, dessen Quellen auf einer Geschichte basieren, die auf einer Legende basiert, die irgendwann mal irgendwer irgendwo gehört und fleißig ausgeschmückt hat. Was davon Wahrheit und was Fiktion ist, weiß niemand, und das ist eine der vielen Fragen, denen wir beim Übersetzen auf den Grund gehen dürfen, die uns verwirren (Briten? Britonen? Engländer?? Wie war das eigentlich im 6. Jahrhundert?), erhellen (Vorpostenkastell versus Meilenkastell, ha) und erheitern (Pechnase!).
Nachdem uns der Auftrag vom Verlag erteilt wurde, ist der erste Schritt allerdings immer die Aufteilung des Textes: nach Erzählperspektiven, nach eigenen Interessen, halbe-halbe … Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir entscheiden je nach persönlichen Vorlieben (Alex liebt Romananfänge!) und Struktur des Textes. Dieses Projekt haben wir strikt hälftig aufgeteilt (diesmal kriegt Heide den Anfang! Agiles Arbeiten und so) und uns dann kopfüber ins Manuskript gestürzt wie Collum in den Brunnen von Camelot. Die Übersetzung an sich ist also immer noch ein Individualwerk, die Zusammenarbeit gestaltet sich allerdings notwendigerweise intensiv, um den Text wie aus einem Guss klingen zu lassen und keine Inkonsistenzen bei Vokabel- und neologistischen Kreativitätsfragen einzubauen (Machen wir aus den „piskies“ für die deutsche Leserschaft „Pixies“? Oder gar „Kobolde“? Nö. „Piskies“ sind super).
Historisch korrekt – geht das überhaupt?
Nun muss also das Glossar festgezurrt werden – jeder Begriff in der 200 Zeilen langen Tabelle kommt auf den Prüfstand, wird nach historischen und ästhetischen Gesichtspunkten debattiert, noch mal ausführlich in die Recherchemangel genommen und dann entweder geändert oder abgesegnet. Allgemeine Entscheidungen wie „Wollen wir Maßeinheiten übersetzen oder lokalisieren?“ oder „Kanonenkugeln gab es damals noch gar nicht, lassen wir die trotzdem drin?“ werden getroffen, aber auch feinere Aspekte abgestimmt. Anachronismen verwendet der Autor nämlich erklärtermaßen gern (gut begründet in seiner Anmerkung; entsprechendes Chatzitat zur ewigen Duz-Problematik jeder Übersetzung: „Aber ist das historisch korrekt? 🤪 Oder scheiß auf historical correctness, weil Grossman selbst drauf scheißt? Oder sind die Tafelrundenritter eh so krass nah, weil sie zusammen Leute erschlagen und Abenteuer suchen (und scheißen), dass sie sich duzen würden?“), was uns als Übersetzerinnen wiederum größere künstlerische Freiheit schenkt.
Heide kann in der Übersetzung des alten Klassikers „König Artus und die Ritter der Tafelrunde“ von Sir Thomas Malory den „Gefährlichen Sitz“ verifizieren, will aus „Villiars dem Tapferen“ aber lieber „Villiars den Wackeren“ machen. Alex hat einen Nautikerfreund, der ihr den Unterschied zwischen dem „Halsen“ und „Wenden“ eines Schiffs erklärt. Es ist faktisch unmöglich, in allen Fachbereichen bewandert zu sein, die ein Roman wie „The Bright Sword“ auffährt, und ohne Paralleltexte, ohne ein Netzwerk aus Seefahrern, Jägern und Schwertkämpfern mit Kontakten zu einem entsprechenden Verein (dem Heide beinahe beigetreten ist), könnte es nicht gelingen, einen runden deutschen Text daraus zu machen.
Frischer Wind auf Camelot
Wir schlagen uns Huten, Häue und Bindungen um die Ohren (Techniken, Turnierregeln und gängige Mittelalterstereotype beißen sich hart!), verzweifeln an der genauen Definition eines „flampet“ (ein derart dekadentes Gebäckstück, dass selbst Sir Bedivere es nicht herunterkriegt) und teilen besonders gelungene Übersetzungen miteinander. Der Humor in „The Bright Sword“ ist so fein, so unterschwellig, dass man ganz schön feilen muss, bis man das hehre Ziel der Wirkungsäquivalenz erreicht hat, aber wenn man es dann schafft, ist die Freude groß. Die teilweise flapsigen Sprüche der Figuren stehen in erfrischendem Kontrast zur Welt eines mittelalterlichen Königshofs, die man ja eher mit gehobener Sprache in Verbindung bringen würde – wobei Grossman sich generell mit Glamour ordentlich zurückhält und das Augenmerk bewusst auf die Antihelden legt, auf den depressiven Hofnarren, auf den trans Ritter und den Konvertiten. Wir feiern die coole Nimue, die den übergriffigen Merlin auflaufen lässt, überlegen, dass der Moslem Sir Palomides ja auch ein wandelnder Anachronismus ist – einer, den wir auf keinen Fall glattgebügelt bekämen, wenn wir denn wollten –, und freuen uns an der Diversität, die der Roman der Artus-Sage angedeihen lässt.
Das heutige Telefonat endet mit einem gänzlich grün markierten Dokument (grün für: Begriff durchgesprochen und abgesegnet), mit einer eigens verfassten Content Note für die im Buch reproduzierten Rassismen und mit der Hausaufgabe, die zahlreichen gotteslästerlichen Flüche im Roman konsequent mit „Heilands[Nomen hier einfügen]“ zu lösen: Heilandssack, Heilandsgebein … Bei solchen Entscheidungen sind wir besonders gespannt, wie unsere Lösungen ankommen.
Per Puzzle zur Perfektion (oder zumindest dicht dran)
Während der Übersetzung stehen wir also über das Glossar, die Telefonate und unseren Chat („Wie doll kringeln sich deine Fußnägel bei ‚Sir‘ plus ‚Parzival‘?“) in Dauerkommunikation. Bis kurz vor der Deadline sitzen wir dennoch „allein“ an dem Text – dann geben wir ihn zur jeweils anderen ins Lektorat. Wir puzzeln, gleichen an, schieben die Übersetzung näher an den Ausgangstext ran oder werden freier, wenn es sein muss. Wir kennen die Geschichte zwar, kennen die Stimme des Autors, aber der Text der Kollegin ist eben nicht die eigene Übersetzung, was einen ganz anderen Blick ermöglicht. Bis zur Veröffentlichung muss das Buch noch ans (externe) Lektorat und in den Satz, dann zur Fahnendurchsicht wieder zu uns auf den Schreibtisch … und irgendwann steht es gedruckt im Laden und macht hoffentlich viele Leserinnen und Leser glücklich.
Als Übersetzerinnen dürfen wir bei so einem Roman jede Menge lernen und nicht nur in die magische Welt des Buches eintauchen, sondern uns auch Flüche, Fakten und Fachtermini erarbeiten, mit denen wir sonst nicht in Verbindung gekommen wären – und die wir hoffentlich bei einem zukünftigen Projekt wieder anwenden können. Wir jedenfalls freuen uns schon auf unsere nächste Tandemübersetzung. Huzzah!
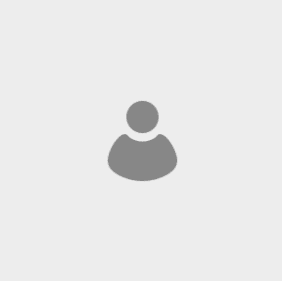
Heide Franck
Heide Franck arbeitet als freiberufliche Übersetzerin und Lektorin für Englisch und Schwedisch und engagiert sich zudem in der BücherFrauen-Akademie. Zusammen mit Andreas G. Förster und André Hansen hat sie im Herbst 2022 das Projekt „Kollektive Intelligenz“ ins Leben gerufen, um – gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds – die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf das Literaturübersetzen zu erforschen.
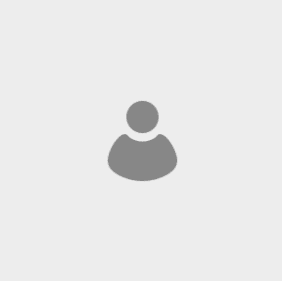
Alexandra Jordan
Alexandra Jordan (*1992) lebt in Münster und übersetzt Literatur (Ernest Cline, Matt Ruff) und Videospiele.