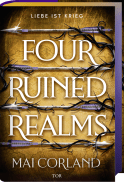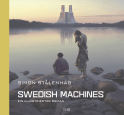Berlin 2099 – Erkunde die Cyberpunk-Metropolis!

Lars Schmeink
Dickes B, ja klar, aber nix mehr mit „dreckig und laut“ – Peter Fox braucht `nen neuen Slogan für das Berlin im Jahr 2099. Zumindest wenn man dem Comic Metropolia von Fred Duval und Ingo Römling Glauben schenken darf. Dort ist Berlin immer noch riesig, aber fast ausschließlich zu Fuß zu durchqueren. Was noch so passiert in der Hauptstadt hat unser Autor Lars Schmeink erkundet.
Die Geschichte von Metropolia ist recht einfach zusammengefasst: der Privatdetektiv Sascha wird von dem Wohnungs- und Stadtentwicklungskonzern Metropolia beauftragt einen Mord aufzuklären, weil ein GPS-Signal die Mörderin in einem ihrer Wohnkomplexe verortet. Weil aber der Komplex riesig ist und eine Art urbane Parallelwelt, die in den 2030ern als Prestige-Smart-Housing-Projekt mit starker KI von einem exzentrischen Architekten entworfen wurde, geht Sascha Undercover als Architekt und Stadtplaner in das „Florian“. Dabei deckt er weit mehr auf, als nur einen einfachen Mord … es geht um Politik, Intrigen, Erpressung und vieles mehr.
Metropolia ist ein Comic des französischen Autors Fred Duval, der von der Berliner Comiclegende Ingo Römling gezeichnet wurde. Römling ist ein Star des deutschen Comics und zeichnet u.a. für Disney an Star Wars, dürfte Metal- und Dark-Wave-Fans aber durch seine Arbeiten für diverse Bands bekannt sein, deren Albencover er gestaltet. Was Autor und Zeichner in diesem Falle wohl aber eint, ist eine Liebe für den Cyberpunk der 1980er Jahren – William Gibsons Neuromancer lässt hier grüßen. Metropolia könnte grafisch, wie auch in der Story, direkt an Warren Ellis‘ Transmetropolitan-Reihe anknüpfen, die wiederum an die Arbeiten von Moebius, vor allem dessen Geschichte „The Long Tomorrow“, erinnern. Nicht umsonst verweist Römling in seiner Bio-Notiz direkt auf seine Liebe für das Magazin Métal Hurlant (auf deutsch: Schwermetall), in dem „The Long Tomorrow“ erschien.
In Sachen Cyberpunk fallen an Metropolia entsprechend die Rückbezüge sofort auf: So ist Protagonist Sascha ganz klar an Ellis‘ Hauptfigur Spider Jerusalem angelehnt, inklusive der markanten Tattoos, polierten Glatze und drahtigen Natur. Die Straßenschluchten Berlins, die riesigen autark-existierenden Wolkenkratzer mit Schukarton-Appartments haben ebenfalls eine lange Tradition im Cyberpunk – von Moebius zu Ellis (vermutlich inspiriert durch Fritz Langs Metropolis), von Gibsons Arkologien bis zu Judge Dredds Megacities. [Mehr Infos und wissenschaftliche Auseinandersetzung zu den Megacities und anderen Cyberpunk Visualitäten gibt es hier.]
Und auch in Sachen Figuren ist der einsame Detektiv, der Lone Wolf, der Ronin, eine Figur, die wir in vielen Cyberpunk-Werken wiederfinden, von Case in Neuromancer bis zu Takeshi in Altered Carbon. Auch Sascha ist ein Mann der Grauzone, mal Gangster, mal Cop, irgendwie im „Low-Life“ des Cyberpunk aktiv, aber ambitioniert, da raus zu kommen: er spart auf genug Geld, um zu seiner Freundin in den USA zu reisen und dem urbanen Leben zu entfliehen. Sein Garten Eden wartet irgendwo in Tennessee. Als Cyberpunk-Fan kommt man also bei Metropolia voll auf seine Kosten und kann so richtig in der Nostalgie dieses Genres schwärmen. Doch der Comic ist bei Weitem kein simpler Abklatsch, sondern versucht sich in einem cleveren Update…
Denn der Cyberpunk der 1980er Jahre hat selbst ein nostalgisches Problem, hängt er doch sehr den Zukunftsbildern der 1950er Jahre und ihren von Neonröhren beleuchteten und von technischen Gadgets so wunderbar einfach gemachten Zukunft nach. Cyberpunk könnte man entsprechend als eine Retrozukunft beschreiben – oder wie William Gibson es in The Gernsback Continuum sagt: als „semiotischen Geist“ einer Zukunft, die nie eingetreten ist. Besonders deutlich wird dieses Umherspuken alter Zukünfte im massiven Energiebedarf, den Welten wie die von Neuromancer, Snow Crash oder auch Blade Runner benötigen. All die künstlichen Intelligenzen, technischen Errungenschaften und parallelen Computerwelten benötigen eine riesige Menge Strom – und wie wir aktuell wissen, ist der fossile Brennstoff, der nötig ist, diesen Hunger zu stillen, gerade das größte Problem, dem wir uns gegenübersehen. Der Cyberpunk hat die Frage des Energiebedarfs all der schönen neuen KI-Welten aber nie adressiert. Entsprechend geistert die Lücke „Klimawandel“ durch fast alle Cyberpunk-Texte – nicht so aber in Metropolia.
Berlin ist im Jahre 2099, so postuliert der Comic, zur größten Metropole Europas angewachsen, hat sich aber irgendwann im 21. Jahrhundert angesichts des Klimawandels dazu entschlossen der CDU-Politik einer Autohauptstadt den Rücken zu kehren. Stattdessen gibt es bare Münze für jeden Schritt zu Fuß, und alle Energie, die verbraucht wird, wird im Gegenzug besteuert. Die Idee, dass die BVG zu einem Luxusgut werden könnten, ist eine wilde These, aber konsequent, wenn man den CO2-Fußabdruck wirklich ernst nimmt. Kein Wunder also, dass Schritte zu einer Art paralleler Währung werden, mit der man Objekte und Dienstleistungen kaufen kann.
Anders als in den meisten Cyberpunk-Texten, ist in Metropolia der Klimawandel allgegenwärtig – von den schattigen Alleen für die Millionen Fußgänger und Fahrradfahrer, über die Szenen schwer atmender Mieter, die in den 12. Stock über die Treppen ihres Wohnhauses müssen, bis zur Politik der Subvention jedes Schrittes inklusive Technologien, die solche Treppenstufen messen und automatisiert abrechnen. Was, so fragt der Comic, würde eine solche ideologische Umstellung gegen das fossile Brennen bedeuten? Wo lägen die Widerstände dagegen? Welche neuen Technologien würden dies befördern? Welche sozialen Interaktionen? Im konsequenten Durchdenken dieser Frage liegt die Stärke des Comics und sein wirklich spannender Beitrag zum Genre. Fragen zu starker KI, zu Korruption und der Macht der Megakonzerne gibt es natürlich auch, aber das kritische Potential des Comics liegt eindeutig in einer Welt, in der der Klimawandel Realität ist und sich alles um dieses Faktum herum zu arrangieren hat.