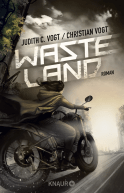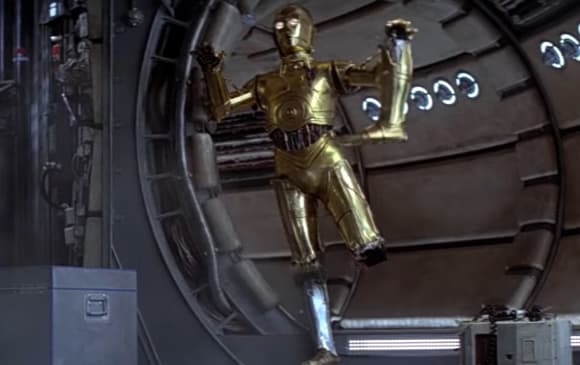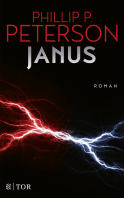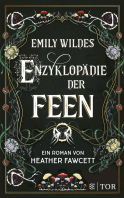Raus aus dem Arkham Asylum – neuere Darstellungen von psychischen Erkrankungen in der Phantastik

Lena Richter, 21.09.2023
Psychische Erkrankungen sind ein beliebtes Plotmittel in der Phantastik. Warum ihre Darstellung oft problematisch ist und wie es besser geht, zeigt uns Lena Richter.
In meinem letzten Artikel zu Behinderung und Krankheit in der Phantastik hatte ich angemerkt, dass ich psychische Erkrankungen auslassen werde, da diese genug Stoff für einen eigenen Artikel bieten würden. Und netterweise darf ich diesen Artikel jetzt schreiben! Los geht es also mit einem Überblick zu schädlichen Darstellungen, uncoolen Klischees und dann auch vielen Beispielen, die es in letzter Zeit (teilweise) besser gemacht haben.
Ich werde auch hier mit einem Disclaimer anfangen: Ich beschränke mich auf psychische Erkrankungen und greife nicht noch das Thema Neurodiversität/Neurodivergenz auf. Zur Unterscheidung sei gesagt, dass es sich bei dem Begriff Neurodivergenz um ein relativ neues und bisher noch nicht unter allen Fachleuten anerkanntes soziologisches Konzept handelt, das zum Ziel hat, zur Ent-Stigmatisierung und Ent-Pathologisierung von Gehirnfunktionen oder -entwicklungen, die von festgelegten Normen abweichen, beizutragen. Diese Abweichung von einer neurotypischen Norm kann zwar in Leidensdruck und komorbide Erkrankungen münden, aber das muss nicht zwingend passieren. Beispiele sind Autismus oder AD(H)S. Zwar werden beide als psychische Diagnosen nach den international verwendeten Klassifikationssystemen behandelt, aber sie sind unter dem Blickwinkel des Neurodivergenz-Konzepts keine Erkrankungen in dem Sinne, dass Betroffene zwingend darunter leiden oder dass sie durch eine Behandlung verschwinden würden. Oft ist es eher die auf neurotypische Menschen ausgerichtete Umgebung und der Druck, sich an diesen anzupassen, die zu Leidensdruck und ggfs. tatsächlichen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen etc. führen kann. Und ebenso wie Menschen mit psychischen Erkrankungen sind auch neurodiverse Menschen in der Phantastik oft nicht oder nicht gut repräsentiert, aber da ich mich selbst als neurotypisch einordnen würde, überlasse ich nähere Betrachtungen und Einschätzungen zu diesem Thema lieber anderen.
Übrigens sehen auch nicht alle Betroffenen von psychischen Krankheiten, die nach den oben genannten Klassifizierungen diagnostizierbar sind, ihren Zustand zwingend als Erkrankung an. So gibt es gerade im Bereich von Bipolarität oder Borderline ebenfalls Betroffene, die sich eher als neurodivers bezeichnen würden. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach und hängt auch sehr davon ab, ob die betroffene Person darunter leidet und sich selbst eine Veränderung wünscht.
„I’m not a monster“ – Falsche und stigmatisierende Darstellungen
Im zweiten Teil werde ich einige in meinen Augen gut gelungenen Beispiele von Figuren mit psychischen Erkrankungen bzw. dem Umgang damit vorstellen, doch zuvor möchte ich kurz auf die Risiken und Gefahren von falschen und stigmatisierenden Darstellungen eingehen.
Gerade in der Phantastik, und dort vor allem in den düstereren Geschichten wie Horror, manchen Superheld*innengeschichten oder auch Dark Fantasy, finden sich leider oft noch klischeehafte und falsche Darstellungen von psychisch erkrankten Menschen. Beispielsweise gibt es in Horrorgeschichten oft den „verrückten Mörder“, der wahlweise Menschen tötet, weil er sadistische Freude daran hat oder weil Stimmen im Kopf es ihm befehlen. Dabei werden dann oft noch die Begriffe wild durcheinandergeworfen und es wird von Schizophrenie gesprochen, wo eine dissoziative Identitätsstörung gemeint ist, die in der Popkultur aber auch nicht so heißt, sondern „gespaltene Persönlichkeit“ genannt wird; es wird von Psychopathie gesprochen, die es als Diagnose gar nicht mehr gibt, usw. Das führt dann beispielsweise zu einer Stigmatisierung von an Schizophrenie erkrankten Menschen, die als fälschlich als besonders gefährlich für die Menschen in ihrer Umgebung gehalten werden. Diese falsche Einordung führt dann wiederum zu noch mehr Hürden für erkrankte Menschen. Zu diesem Thema kann ich sehr den Blogartikel von Elea Brandt empfehlen, in dem das alles noch einmal genauer beleuchtet wird.
Problematisch ist es auch, wenn eine Figurenzeichnung sich gar nicht erst mit speziellen diagnostizierten Erkrankungen beschäftigt und Charaktere „einfach verrückt“ sein lässt. Völlig unberechenbare, überdrehte und sich an Gewalt erfreuende Figuren wie der Joker aus Batman oder auch teilweise der Master aus Doctor Who mögen eine Geschichte gut voranbringen, weil man sie alles tun lassen kann, was der Plot gerade benötigt, aber auch sie tun echten psychisch kranken Menschen keinen Gefallen.
Ein anderer Aspekt falscher Darstellung betrifft die Romantisierung und Verklärung von psychischen Erkrankungen. So werden beispielsweise Depressionen und Suchterkrankungen oft sowohl innerhalb von Geschichten als auch bezogen auf Künstler*innen selbst als eine Art düstere Quelle von Kreativität und tragischer schöpferischer Wirkmacht angesehen. Erzählungen über gequälte Figuren, die ihren Schmerz in Text, Musik oder Bild umsetzen und damit das Publikum begeistern, sind beliebt. Oft schwingt darin mit, dass ohne die Erkrankung ja vielleicht die Kunst weniger gut und intensiv wäre. Ob die betreffenden Figuren (oder schlimmstenfalls echten Menschen) vielleicht einfach lieber gesünder wären und dafür andere oder gar keine Kunst mehr machen würden, wird selten gefragt. Auf diese Weise wird suggeriert, dass die Erkrankung ja auch ihre „guten Seiten“ hat und dass womöglich eine Gesundung sogar den künstlerischen Ausdruck und damit auch den Ruhm oder gar das Einkommen mindern könnte. Die Vorstellung, dass bei einer Verbesserung des eigenen Gesundheitszustandes womöglich Unterstützung und Einkommen wegfallen könnte, macht es Betroffenen womöglich noch schwerer, sich Hilfe zu suchen.
Und apropos Hilfe: Besonders schädlich und schlimm sind falsche Darstellungen, wenn sie sich auf Methoden und Orte beziehen, an denen psychisch kranke Menschen Hilfe erfahren. Gerade psychiatrische Abteilungen von Krankenhäusern werden auch heute noch oft als Horror-Orte dargestellt, an denen Menschen gefesselt, mit Medikamenten betäubt und misshandelt werden – berühmtestes Beispiel ist sicherlich das Arkham Asylum aus dem Batman-Universum. Nun ist es nicht so, dass Psychiatrien, gerade die geschlossenen Abteilungen, schöne Orte wären. Aber weder sind sie fensterlose dunkle Kellergebäude noch werden Menschen dort in erster Linie gequält. Wie schwer es fallen mag, sich in stationäre Behandlung zu begeben, wenn man psychiatrische Kliniken aus den Medien in erster Linie als eine Art Folterkammer kennt, kann man sich vermutlich ausmalen. Und versteht mich nicht falsch, man könnte über unser Gesundheitssystem und den Umgang mit psychisch Kranken ganz sicher sehr viele Geschichten erzählen, die wahr sind und dennoch gut ins Horror-Genre passen würden, von Fehldiagnosen, völlig überfüllten Krankenhäusern, ewigem Warten auf Behandlung und endlosen, zermürbenden Kämpfen mit Behörden und Krankenkassen. (Und es wäre gut, wenn sie erzählt würden, auch in einem phantastischen Kontext!) Meine Aussagen beziehen sich hierbei außerdem auf die Gegenwart, in der Vergangenheit war das Pathologisieren von beispielsweise Frauen, die in Nervenheilanstalten schlichtweg eingesperrt wurden, wenn sie zu aufmüpfig wurden, ebenfalls ein sehr realer Horror.
Aber generell ist es sehr schädlich, die Orte, an denen Menschen Hilfe und eine Verbesserung ihrer Situation erfahren, als billige Horrorkulisse zu missbrauchen. Dasselbe gilt auch für Behandlungsmethoden: Nicht alle psychisch Kranken brauchen Medikamente und es ist eine Herausforderung, die richtige Medikation in der richtigen Dosis zu finden und auch bezüglich der Nebenwirkungen so einzustellen, dass sie verträglich ist. Aber die Darstellung von Medikamenten als etwas, das nur betäuben und ruhigstellen soll, ohne wirklich zu helfen, baut ungute Vorbehalte auf. Ein weiteres Beispiel ist die Elektrokonvulsionstherapie, die oft mit den Foltermethoden der Vergangenheit vermischt wird, bei denen in der Tat Verhaltensänderungen mit Elektroschocks erzwungen werden sollten. Die Elektrokonvulsionstherapie hingegen ist eine Behandlungsmethode, die bei Menschen mit schweren Depressionen oder Schizophrenie, die auf andere Behandlung nicht ansprechen, angewendet wird und oft gute Erfolge erzielt. Auch hier können falsche Darstellungen so viel Angst erzielen, dass sich Menschen vielleicht gar nicht erst mit der Möglichkeit einer Behandlung auseinandersetzen, die ihnen helfen könnte.
Schlussendlich noch ein schädliches Trope, das sich nicht nur auf psychische, sondern auch auf physische Erkrankungen beziehen kann: Die Wunderheilung. Die depressive Person musste nur die Liebe ihres Lebens finden, und schon ist ihre Depression wundersam verschwunden. Die schizophrene Person, die Stimmen hört, muss nur herausfinden, was ihr in der Kindheit passiert ist, und schon löst alles sich in Wohlgefallen auf und sie hat wieder ihre Ruhe. Hier wird negiert, dass Besserung bei einer psychischen Krankheit natürlich möglich ist und dass z. B. depressive Episoden, die nicht chronifiziert sind, auch ganz geheilt werden können, dass dies aber ein längerer Prozess ist, der mit Therapie, eventuell medikamentöser Behandlung und Änderung der Lebensumstände einhergeht und nicht wie auf Knopfdruck durch ein singuläres Ereignis erfolgt. Solche Darstellungen können entmutigen und verunsichern, wenn sich im echten Leben eben nicht durch eine neue Beziehung oder eine Erkenntnis über die eigene Vergangenheit wundersame Heilung einstellt.
„He’s always here” – Trauma und PTBS
Um nun aber zu den angekündigten Beispielen zu kommen, die psychische Erkrankungen besser darstellen, sei hier als erstes auf einige Serien verwiesen, die sich dem Thema Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auf eine gute Weise gewidmet haben. Eigentlich ist es ja naheliegend: Die Dinge, die beispielsweise Superheld*innen oder Raumschiffcrews erleben, sind oft schlimm, gefährlich, mit Ängsten, Nahtoderlebnissen und Verlusten verbunden. Da ist es kein Wunder, dass erlittene Traumata nicht spurlos vorbeigehen. Allerdings ist das reine Andeuten eines Traumas (das auch nicht als solches benannt wird), wie es z. B. Iron Man nach seiner Nahtoderfahrung in Avengers zeigt, noch keine wirklich gut gelungene Repräsentation. Mehr Fokus auf das Thema richtet die erste Staffel der Netflix-Disney-Serie Punisher, die nicht nur Frank Castles PTBS immer wieder sehr eindringlich durch Flashbacks und Albträume darstellt, sondern die auch generell die psychischen Probleme von Kriegsveteran*innen beleuchtet. Die in der Serie immer wieder gezeigte Selbsthilfegruppe, deren Mitglieder versuchen, trotz ihrer schlimmen Kriegserlebnisse wieder Platz im neuen Alltag zu finden, räumt dem Thema auch jenseits der gewalttätigen und grausamen Rachefeldzüge des Punishers Platz ein. Trotzdem gibt es auch Kritik an der Darstellung, ein Artikel weist z. B. darauf hin, dass die tragische Geschichte einer Nebenfigur, die in einem Flashback den eigenen Vater erschießt, eher untypisch ist und Vorbehalte gegen Veteran*innen schüren kann, die in Wirklichkeit ein höheres Risiko für Suizid als für Gewalt gegenüber anderen haben.
Noch besser erzählt die im selben Serien-Universum angesiedelte Serie Jessica Jones von posttraumatischer Belastung. Und vor allem: Sie tut es mit diesen Worten und ergeht sich nicht in Andeutungen und Fingerzeigen. Jessica ist Opfer des Antagonisten Killgrave geworden, sie wurde misshandelt und vergewaltigt und hat davon PBTS davongetragen. Während sie zwar aktuell nicht in therapeutischer Behandlung ist und – durchaus realistisch – im Alkoholmissbrauch Erleichterung und Trost sucht, hat sie dennoch einige Methoden erlernt, mit denen sie ihre Flashbacks und Panikattacken bekämpfen kann. Immer wieder wird gezeigt, wie sie sich mit einem Mantra versichert, im Hier und Jetzt zu sein. Sie organisiert eine Selbsthilfegruppe für andere Menschen, die Opfer von Killgrave geworden sind, und dort kommt auch zur Sprache, wie schlimm es für sie ist, anderen unter dem Einfluss von Killgrave Schlimmes angetan zu haben. Darin könne man, so ein Artikel zur Serie, durchaus eine Metapher sehen, in der Killgrave das tut, was psychische Erkrankungen anrichten: Die Betroffenen tun schreckliche und grausame Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Wenn es ihnen besser geht, schämen sie sich dafür, was sie angerichtet haben und fragen sich, ob es erneut passieren kann. Jessica selbst jedenfalls kann Killgrave in der ersten Staffel der Serie besiegen – aber dadurch erfolgt keine Wunderheilung. Auch in der zweiten Staffel ist sie ihre Flashbacks nicht losgeworden und kämpft weiter mit ihrer PTBS. Damit erkennt die Serie an, dass es eben keine schnelle, einfache Lösung gibt, um psychische Erkrankungen loszuwerden, sondern sie Betroffene oft ein Leben lang begleiten und diese lernen müssen, mit ihnen umzugehen.
Ein halb gut gelungenes Beispiel gibt es in der dritten Staffel Star Trek: Discovery. Nachdem die Crew am Ende der zweiten Staffel eine schwere Entscheidung treffen muss und sich in Staffel 3 in einer völlig neuen und unbekannten Umgebung wiederfindet, haben viele von ihnen mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen. Besonders heftig trifft es die Pilotin Detmer die immer wieder Herzrasen und Atemnot bekommt. Culber, einer der Bordmediziner, erkennt darin PTBS und Panikattacken und legt Detmer und der gesamten Crew nahe, sich einzugestehen, dass die Ereignisse nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sind. Allerdings bleibt es dann bei dieser Erkenntnis. Detmers Erkrankung wird nicht wirklich weiter thematisiert; sie wird weder krankgeschrieben noch sehen wir Behandlungen (oder hören davon, dass diese Off-Screen erfolgen), irgendwann geht es ihr dann einfach besser. Das ist leider ein Problem vieler Serien, die psychische Erkrankungen überhaupt thematisieren – für die angemessene Behandlung ist im Plot dann doch kein Platz.
Ähnlich ist es auch in der Arrowverse-Serie Batwoman, in der Luke Fox nach einer traumatischen Nahtoderfahrung ebenfalls PTBS entwickelt. Die Serie geht gut damit um, wie er es nicht wahrhaben will und dann doch einsehen muss, aber auch dort erfolgt dann die Heilung mittels eines „er muss sich nur einmal richtig überwinden“-Plotpoints. Allerdings muss ich die Serie doch dafür loben, dass sie nicht nur in diesem Plotstrang psychische Erkrankungen thematisiert, sondern vor allem in Staffel 3 auch einen längst notwendigen kritischen Blick auf das Arkham Asylum (das so etwas wie die Verkörperung aller schlimmen Psychiatrie-Klischees darstellt) wirft. Vor allem über Mary Hamilton, die Bat-Team-Ärztin, wird klargemacht, dass dort die Insass*innen nicht geheilt, sondern gequält werden, und dass es bessere Wege geben muss, mit denen umzugehen, die aus Krankheitsgründen nicht unbedingt etwas für ihre Taten können. Auch das macht die Serie nicht perfekt und auch hier gibt es noch zu viel Heilung durch Wundermittel, aber es wird immerhin überhaupt thematisiert.
Insgesamt sind Traumata und PTBS vermutlich eine der am meisten thematisierten psychischen Erkrankungen in der Phantastik. Das liegt sicherlich auch daran, dass man sie gut „erklären“ kann, denn die Protagonist*innen erleben viele schreckliche Dinge. Darin liegt aber auch gleichzeitig ein weiterer Kritikpunkt, denn im echten Leben braucht es nicht zwingend Nahtoderfahrungen, getöteten Familien oder gedankenkontrollierende Serienmörder, damit Menschen PTBS entwickeln. Auch z. B. Unfälle, Gewalterfahrungen im sozialen Nahraum, Krankheiten und medizinische Notfälle bei sich selbst oder nahestehenden Menschen können die Ursache sein. Es wäre wünschenswert, wenn auch in phantastischen Geschichten solche auslösenden Ereignisse als ebenso valide Ursachen repräsentiert wären.
„But we carried on“ – Figuren sind mehr als ihre Krankheit
Wie auch bei anderen Erkrankungen, Behinderungen oder bei marginalisierten Identitäten gibt es leider immer noch sehr viele Geschichten, in denen Repräsentation dann so erfolgt, dass es nur um die psychische Erkrankung der Person geht. Gerade antagonistische Figuren wie z. B. der Joker aus dem Batman-Universum werden ausschließlich durch ihre (nicht näher spezifizierte) „Verrücktheit“ charakterisiert. Doch es gibt auch Beispiele aus jüngeren Werken, in der gerade auch Protagonist*innen und Perspektivfiguren eine psychische Erkrankung haben, die aber eben, wie bei echten Menschen auch, nur einen Teil ihrer Persönlichkeit ausmacht. Gut gelungen finde ich beispielsweise die Hauptfiguren in Mary Robinette Kowals Lady Astronauts-Romanen. Elma York, die Hauptfigur der ersten beiden Bände, hat eine Angsterkrankung, die ihr vor allem öffentliche Auftritte und konfrontative Gespräche erschwert und mit körperlichen Symptomen wie Schweißausbrüchen oder Erbrechen einher geht. Gleichzeitig ist sie eine fähige Pilotin und begnadete Mathematikerin. Dass sie als Frau in den 1950-ern ihre Erkrankung auch vor ihren Kolleg*innen verstecken muss, damit sie nicht allein schon deshalb aus dem von ihr so sehr angestrebten Raumfahrtprogramm fliegt, zeigt noch eine zusätzliche diskriminierende Struktur auf – die auch leider in der heutigen Zeit noch aktuell ist (beispielsweise wurde erst vor kurzer Zeit entschieden, dass eine erfolgte Psychotherapie nicht mehr automatisch einen Ausschluss von der Verbeamtung von Lehrkräften zur Folge hat). Auch Kowals zweite Hauptfigur aus der Lady Astronauts-Reihe, Nicole Wargin ist Pilotin, gewieft im Ausspionieren und auf dem politischen Parkett, und leidet gleichzeitig seit vielen Jahren unter Anorexie, muss sich zum Essen zwingen und ist vor allem bei ihren Missionen auf der Mondstation sehr davon belastet, dass ihre einzige Vertrauensperson in dieser Hinsicht ihr dort nicht beistehen kann. Auch hier ist Nicoles Erkrankung nur ein Aspekt der Figur, der zwar immer wieder, auch sehr eindringlich geschildert, vorkommt, sie aber nicht davon abhält, fähig und mit Erfolg ihre Mission auszuführen.
Ähnlich gut gelungen ist die Hauptfigur Renia in Swantje Niemanns Das Buch der Augen, die schon von Beginn des Buches an in einer depressiven Phase ist und im Laufe der Handlung zusätzlich noch eine Anorexie entwickelt. Gleichzeitig ist sie aber auch in ihre komplizierte Familiengeschichte und das Bekämpfen von Dämonen verwickelt, sodass auch hier die Erkrankungen zwar da sind, aber die Protagonistin nicht handlungsunfähig machen oder nur noch auf ihre Krankheit beschränken. Auch die Art, wie Renias Gedanken um Essen und Kalorien kreisen, ist meiner Meinung nach zwar sehr plastisch geschildert, gleitet aber nicht in voyeuristisches Zur-Schau-Stellen ab.
„You see, I am insane“ - Psychische Erkrankungen und unzuverlässige Erzählfiguren
Ein besonders spannendes Beispiel einer psychisch kranken Hauptfigur findet sich in Harrow the Ninth (dt. Ich bin Harrow) von Tamsyn Muir. Harrow, aus deren Sicht erzählt wird, betont immer wieder, dass sie sich auf ihre Wahrnehmung nicht immer oder vollständig verlassen kann. In selbstverständlichem Tonfall spricht sie von sich selbst als „verrückt“ und erzählt, wie sie schon seit ihrer Kindheit von einer Person begleitet wird, die sie sich nur einbildet. Und auch mit Harrows Erinnerungen an Teil 1 der Buchreihe (der aus einer anderen Perspektive erzählt war) stimmt ganz offensichtlich etwas nicht. Und als wäre das alles nicht schon verwirrend genug, gibt das Setting des Romans schlicht her, dass auch alles, was Harrow sieht und wahrnimmt, tendenziell echt sein könnte, wandelnde Tote und geisterhafte Begleiterinnen mit einbegriffen. Weder die Hauptfigur noch die Lesenden können sich jemals sicher sein, was wahr ist, was nicht, was eingebildet, was übernatürlich und doch real. Damit greift die Autorin eine Erkrankung auf, die sehr, sehr selten einmal auf respektvolle Weise repräsentiert wird: Harrow ist (wie übrigens die Autorin selbst auch) an Schizophrenie erkrankt. Das erfährt man aus dem Nachwort, und in einem Interview berichtet Muir, dass dies auch schon zu abwertenden Rezensionen und Feedback geführt hat, die vielleicht ausgeblieben wären, wenn sie die Erkrankung deutlicher benannt hätte. „There are people who talk about Harrow in terms that are fundamentally thoughtless and unsympathetic to mental illness, and the tragic thing is that I know a lot of people who discuss it would probably rather eat their feet than say something hurtful, but because Harrow doesn’t flag itself up as a story about the mentally ill they have no idea what they’re doing. They almost need those flags to remind themselves to be kind.” Gleichzeitig berichtet sie aber auch, wie viel es ihr bedeutet hat, dass Lesende, die selbst Schizophrenie und Psychosen kennen, sich in dem Buch wiedergefunden haben.
Die Art und Weise, wie der Roman erzählt ist, hat hier also die Erfahrung einer psychischen Erkrankung greifbar gemacht und ist dabei vor allem durch die Du-Perspektive auch sehr nah an den Lesenden. Die Verwendung dieser Erzählform wurde auch in einem Artikel von Fran Wilde einmal aufgegriffen, um über den Unterschied zwischen Mitleid und echter Empathie zu sprechen, der Figuren, die psychisch oder körperlich krank oder behindert sind, oft begegnet.
„A proven method“ – Behandlungen und Hilfsmittel
Auf die Worte „such dir Hilfe“ reagieren viele psychisch kranke Menschen eher ungehalten. Denn die Worte sind leicht dahingesagt, Hilfsangebote zu finden hingegen ist schwer. Wie lange man in Deutschland warten muss, um einen Therapieplatz zu erhalten, ist inzwischen immerhin vielen Menschen bekannt. Sinnvolle Änderungen, um mehr Kapazitäten zu schaffen, hat es seitens der Politik und der Krankenkassen hingegen nicht gegeben. Die Versorgung von psychisch kranken Menschen ist generell nicht gut, und je schwerer deren Erkrankung ist oder je mehr weitere Krankheiten oder auch Marginalisierungen noch hinzukommen (es gibt zum Beispiel sehr wenige Therapeut*innen, die geschult mit dem Thema Rassismus umgehen können, quasi keine Angebote für Menschen, die so schwer krank ist, dass sie das Haus nicht verlassen können, usw.), desto schwerer wird es. Interessanterweise stimmt die traurige Realität hier mit der Phantastik oft überein, denn mir ist ehrlich gesagt keine Geschichte eingefallen, in der eine psychische Erkrankung vorkommt und auch gezeigt wird, wie diese behandelt wird. Das liegt oft am Setting – die verschrobenen Nekromant*innen in der Locked Tombed-Reihe haben ebenso wenig sinnvolle Therapieangebote wie das ohnehin misogyne Raumfahrtprogramm der 1950-er. Es ist durchaus reizvoll zu beleuchten, was man eigentlich tut, wenn psychisch kranke Menschen mangels Infrastruktur und Behandlungsmöglichkeiten nur eingeschränkt Hilfe erhalten können: So wird in Judith und Christian Vogts Romanen Wasteland und Laylayland sehr einfühlsam geschildert, wie der bipolare Protagonist Zeeto von seiner Community aufgefangen und unterstützt wird, wenn es im postapokalyptischen Ödland eben keine Medikamente mehr gibt. Elma York in den Lady Astronauts hingegen behilft sich mit ihrem Ehemann und engen Freundinnen als Vertrauten sowie unter der Hand weitergegebenen Beruhigungstabletten.
Aber auch da, wo es die Möglichkeiten gäbe, werden sie nicht erzählt: Detmers PTBS in Discovery wird off-screen geheilt, Frank Castle hat zwar seine Selbsthilfegruppe, aber keine weitere Behandlung, Jessica Jones war zumindest mal in Therapie, hat diese aber abgebrochen. Wo in nicht-phantastischen Serien gelegentlich Therapeut*innen als Nebenfigur vorkommen und Sitzungen gezeigt werden oder auch Medikamente eine Rolle spielen, scheint dies in der Phantastik noch nicht so recht einen Platz zu haben. Sehr oft endet die Thematisierung von psychischen Erkrankungen an der Stelle, wo die Hauptfigur erkennt, dass es so nicht weitergeht und sie Hilfe braucht, oder eine erfolgte Therapie wird nur in der Vergangenheit platziert. Dabei wäre zumindest in Settings, die in einer Version unserer jetzigen Welt oder in einer fortschrittlichen Zukunft spielen, doch das selbstverständliche Einbinden einer therapeutischen und/oder medikamentösen Behandlung eine gute Möglichkeit, Ängste und Vorbehalte abzubauen. Und auch die Unterversorgung und schwierige Suche nach medizinischer und therapeutischer Anbindung böten eigentlich durchaus gute Ansätze für eine Verarbeitung auch im phantastischen Kontext.
Insgesamt lässt sich also feststellen, dass es inzwischen durchaus gute und gelungene Darstellungen von psychischen Erkrankungen in der Phantastik gibt. Gleichzeitig ist noch deutlich Luft nach oben, gerade was Geschichten angeht, bei denen auch gezeigt wird, wie eine Verbesserung der Erkrankung erfolgen kann. Wenn ihr noch Beispiele kennt, in denen auch das gelungen ist, schreibt sie gerne in die Kommentare auf Facebook oder Twitter.

Lena Richter
Lena Richter ist Autorin, Lektorin und Übersetzerin mit Schwerpunkt Phantastik und veröffentlichte Kurzgeschichten, Essays und Artikel. Lena ist eine der Herausgeber*innen des Phantastik-Zines Queer*Welten und spricht gemeinsam mit Judith Vogt einmal im Monat im Genderswapped Podcast über Rollenspiel und Medien aus queerfeministischer Perspektive. Im Februar 2023 erschien ihre Science-Fiction-Novelle Dies ist mein letztes Lied im Verlag ohneohren. Mehr zu ihr findet ihr auf ihrer Website lenarichter.com oder auf Twitter unter @Catrinity.