
Weltraumgeschichten sind Horrorgeschichten

Emily Hughes, 11.04.2024
Im Weltraum hört dich niemand schreien, heißt es. Doch dafür braucht es gar kein mörderisches Alien, denn dort kann dich alles töten, beim kleinsten Fehler. Emily Hughes erzählt uns, warum das Weltall der blanke Horror ist.
„Science Fiction und Horror sind Geschwister, Zwillinge, die stets versucht haben, sich der Welt als unterschiedlich voneinander zu präsentieren – und stets daran gescheitert sind.“ – W. Scott Poole, Dark Carnivals: Modern Horror and the Origins of American Empire
Solltest du dich einmal in der misslichen Lage wiederfinden, durch die Leere des Weltalls geschleudert zu werden: Nur keine Panik. Nicht weil du sicher bist – das bist du ganz und gar nicht. Aber: In Panik zu verfallen würde dir einfach nichts nützen.
Im besten Fall wirst du von ein bisschen Metall, Glas und sehr genau kalibrierten Lebenserhaltungssystemen vor dem Nichts da draußen geschützt. Vielleicht kommst du also heil aus der Sache raus! Aber nur ein lockerer Bolzen oder ein bisher nicht erkannter Softwarefehler – oder ein Besatzungsmitglied, das, entweder wegen Fahrlässigkeit oder Bösartigkeit oder einer Nacht mit wenig Schlaf, ein wichtiges Warnzeichen missachtet oder einen Schritt in den standardisierten Betriebsverfahren des Raumschiffes vergisst – und schon war‘s das. Oder, Gott bewahre!, der Bordcomputer erlangt ein Bewusstsein und schaltet die Lebenserhaltungssysteme in den Kryokammern aus …
Im schlimmsten Fall aber ist da einfach nichts zwischen dir und der Leere. Dir blieben dann vielleicht gerade einmal zehn Sekunden, um es zurück in eine Luftschleuse zu schaffen (viel Glück dabei!). Nach diesen zehn Sekunden verlierst du das Bewusstsein, was in dem Fall ein wahrer Segen ist, denn so bekommst du nicht mit, wie sich in deinem Blut unter qualvollen Schmerzen Stickstoffbläschen bilden oder wie deine Lunge durch den immensen Druckunterschied zerbirst. Nach ungefähr eineinhalb Minuten bist du tot.
Möglicherweise bist du aber auch auf dem Weg zu einer neuen Welt, einem anderen Planeten, der über eine Atmosphäre verfügt, die vielleicht, oder vielleicht auch nicht, kompatibel ist mit menschlichem Leben, oder dessen Flora und Fauna dir mehr oder weniger direkt den Tod bringen möchte. Selbst wenn du dort sicher ankommst, selbst wenn dein Raumschiff beim Atmosphäreneintritt nicht verglüht, selbst wenn dein Lebenserhaltungssystem hochmodern ist - dann was? Sofern du nicht vorhast, den Rest deines Lebens auf diesem Planeten zu verbringen (wie lange auch immer das sein mag), ist der Weltraum immer noch da und wartet auf dich.
Wartet auf das nächste Mal.
Es gibt nur relativ wenige Arten und Weisen, wie Menschen im Weltraum existieren und überleben können, und gleichzeitig tausende, die zu gar keinem guten Ende führen. Menschliches Versagen, Sabotage, menschenfeindliche Planeten, bösartige außerirdische Lebensformen – das alles kann schlimm sein, klar, aber die größte Bedrohung ist und bleibt das Medium selbst. Als Mensch ist man im Weltraum per Definition nicht in seinem Element. Als Mensch (und ich gehe einfach mal davon aus, dass du, liebe*r Lesende*r, einer bist) begibst du dich in eine Umgebung, in der du ohne erhebliche Anstrengungen und ohne ausgeklügelte Geräte nicht atmen kannst. Jede andere Kreatur, auf die du möglicherweise triffst, ist besser auf diese Umgebung eingestellt als du, was wiederum bedeutet, dass du hier nicht mehr unbedingt an der Spitze der Nahrungskette stehst. Du kannst nur darauf hoffen, dass diese anderen Kreaturen nicht hungrig sind.
Es ist aber so: Die Leere hasst dich nicht. Die Leere weiß nichts von dir, und es kümmert sie nicht, dass es dich gibt; ebenso wenig würde sie mitbekommen, wenn deine Existenz ein Ende fände, oder sich gar um dieses Ende scheren. Die Leere leert einfach so vor sich hin, bis zur Unendlichkeit. Und wenn man es herunterbricht, ist genau das die Grundprämisse von kosmischem Horror: Der Weltraum ist unbekannt, unergründlich, nicht an uns interessiert, und sein Ausmaß ist für uns Menschen unbegreiflich. So unbegreiflich, dass das Wissen über seine bloße Existenz zu spontanem Ego-Tod führen kann. Und jede Geschichte, die dort spielt, ist untrennbar mit dieser immensen Leere verwoben.
Wie also, erzählt man Weltraumgeschichten, in denen auch nicht das kleinste bisschen Horror vorkommt? Ganz einfach: gar nicht. Zugegebenermaßen hat man mir, als Horrorfanatikerin, schon öfter (völlig zurecht) unterstellt, dass ich behaupten würde, dass einfach alles Horror sei (womit ich aber eigentlich recht habe). Aber es ist wie bei der Matrix – wenn man einmal gesehen hat, wie allgegenwärtig Horrorelemente in Geschichten sind, die nicht auf unserem Planeten spielen, kann man das nur sehr schwer wieder ungesehen machen.
Es gibt natürlich Unmengen an ganz klar als Horror ausgewiesenen Geschichten, die im Weltraum spielen (natürlich Alien und Event Horizon, und verpasst nicht S.A. Barnes’ Dead Silence und Ness Browns The Scourge Between Stars, wenn das euer bevorzugtes Subgenre ist). Aber selbst Weltraumgeschichten, die vorgeben, neutral oder gar optimistisch zu sein, enthalten allein aufgrund ihres Settings schon Furchterregendes. Nehmen wir mal Star Wars: Selbst wenn man die Weltraumnazis mal außen vor lässt, fällt mir sofort die Szene ein, in der der Millennium Falke auf einem Asteroiden in einer Höhle landet, die sich als der Schlund eines hungrigen Weltraumwurms entpuppt. Es gibt Wampas und Rancoren und Sarlaccs (oh Gott!), den Massenmord an Kindern, gruselige Machtvisionen in seltsamen Höhlen, planetaren Genozid und riesige, epochale Schlachten, in denen die jeweiligen Feind*innen mit Lasern bearbeitet werden, in der Hoffnung, dass deren Raumschiff zuerst in die Luft fliegt.
Selbst in Star Trek, der optimistischsten Sci-Fi-Reihe überhaupt, sehen sich die Offizier*innen und die Besatzung der Sternenflotte ständig irgendwelchen grauenvollen Situationen und Schicksalen gegenüber. In Raumschiffschlachten halten die Techniker*innen die Kapitän*innen ständig über die strukturelle Integrität der Schiffsaußenhaut auf dem Laufenden – eine eindringliche Erinnerung daran, dass jede durchbrochene Stelle dazu führt, dass die Besatzung in der kalten Schwärze des Weltraums ihr Ende findet (wie etwa in Der Zorn des Khan und Into Darkness). Ein Außenteam hat vielleicht eine Chance von 35 %, in einem Stück zum Schiff zurückzukehren. Allein die Tatsache, dass „Redshirt“ zu einem Synonym für „Kanonenfutter“ geworden ist, zeigt schon, dass Star Trek viel fürchterlicher ist, als es vorgibt zu sein. Es gibt eine Episode in Das nächste Jahrhundert, in der Riker von Aliens entführt wird, die ihm seine Gliedmaßen amputieren und wieder annähen. Und von den Borg wollen wir hier erst gar nicht anfangen.
Aber auch Weltraumgeschichten, die stärker zum Realismus tendieren, stellen hier keine Ausnahme dar. Die schemenhafte Möglichkeit eines kalten und schrecklichen Todes lauert stetig im Hintergrund von Apollo 13, Gravity, Interstellar, Der Marsianer und von so gut wie jedem anderen Film, in dem Astronaut*innen eine Rolle spielen. George Clooneys Tod in Gravity ist dabei noch das Best-Case-Szenario – wenn dir der Sauerstoff ausgeht, schläfst du einfach ein – aber der Gedanke, dass dein lebloser Körper für alle Ewigkeit in der erdnahen Umlaufbahn umherdriftet, stellt eine ganz eigene Art des Horrors dar.
Mein Lieblingsbeispiel von Horrorelementen in weitgehend Nicht-Horror-Geschichten (und eine perfekte Illustration von kosmischem Horror) ist aber wahrscheinlich in Per Anhalter durch die Galaxis zu finden. Douglas Adams hat ganz verschiedene fürchterliche Momente in seine Buchreihe hineingeschrieben (seinen Heimatplaneten in die Luft gejagt zu bekommen, damit eine kosmische Umgehungsstraße gebaut werden kann, gehört definitiv dazu, oder der Moment, als Arthur und Ford aus einer Luftschleuse geworfen werden). Aber nichts ist in der Hinsicht vergleichbar mit dem Totalen Durchblicksstrudel. Dabei handelt es sich um eine Maschine, die dein Gehirn dazu zwingt, die genauen Ausmaße des Universums und gleichzeitig die eigene Geringfügigkeit und Bedeutungslosigkeit in ihm zu begreifen. Sie zerstört den Verstand eines jeden Menschen, der ihr ausgesetzt wird (mit einer bemerkenswerten, in Plot Armor gehüllten Ausnahme). In dieser Welt ist das Wissen darüber, wie unbedeutend du selbst bist, im Grunde genommen ein Todesurteil.
***
Science Fiction und Horror (und Fantasy übrigens auch) stellen die gleiche Frage: Was wäre, wenn? Der Weltraum ist unendlich, und wir Menschen lieben es einfach, gewisse Leerstellen mithilfe unserer Vorstellungskraft zu füllen. Was wäre, wenn es da draußen anderes intelligentes Leben gibt? Was wäre, wenn wir auf dem Mond landen? Dunkle, leere Räume rufen in uns Gedanken darüber hervor, was sich darin verbergen könnte – was wäre, wenn nachts um 3 Uhr eine Hand mit spindeldürren Fingern aus deinem Kleiderschrank hervorlugt? Was wäre, wenn jemand mit gezücktem Messer in der Dunkelheit unter deinem Bett wartet? Was wäre, wenn das Geräusch aus dem Keller nicht die Heizung ist? Was wäre, wenn es da draußen tatsächlich intelligentes Leben gibt und es uns am liebsten tot sehen möchte?
Horrorregisseur*innen nutzen Negativraum, um Spannung zu erzeugen: Unsere Augen fokussieren die leere Stelle im Bildausschnitt, wir halten die Luft an und warten auf das Gesicht des Mörders, das rasende Auto, das Monster, das aus der Dunkelheit auftaucht, als ob es sich gerade erst in unserer Welt materialisiert hätte. Denken wir wieder an Das Imperium schlägt zurück, an die Asteroidenszene, in der der Mynock sich an der Frontscheibe des Millennium Falke festsaugt. Wenn deine Geschichte inmitten der Leere stattfindet, ist der Negativraum allumfassend. Du kannst jederzeit aus jeder Richtung von irgendetwas angefallen werden. Du bist nirgends sicher. Die Frage ist dann: Existiert ab einem bestimmten Punkt überhaupt noch ein Unterschied zwischen der Angst vor dem, was möglicherweise da draußen ist, und der Angst vor dem „da draußen“ selbst?
Die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor der Leere und die Angst vor dem Unbekannten sind quasi ein und dasselbe. Wir möchten wissen, was uns erwartet, damit wir uns vorbereiten können, wir wollen Licht in die dunklen Ecken bringen und sichergehen, dass uns dort nichts auflauert. Nicht immer sind wir dazu in der Lage – manchmal berauben uns die Umstände unserer Handlungsmacht. Und dann wartet da eben ein Mörder vor dem Schlafzimmerfenster, materialisiert sich ein Hai im tiefen Wasser, reißt eine Verbindungsleine und lässt den*die Astronaut*in hilflos vom Raumschiff wegtreiben. Ich habe die Bedrohung nicht kommen sehen, und jetzt schließen sich ihre Zähne um meinen Hals.
Als Kind wollte ich nie Astronautin werden, oder gar Meeresbiologin. Ich hatte schon immer (und habe noch immer) einen gesunden Selbsterhaltungstrieb. Ich schaue mir liebend gerne die Sterne an – aber die dazwischenliegende schwarze Leere? Damit will ich wirklich nichts zu tun haben.
Dieser Beitrag erschien ursprünglich als Every Space Story Is a Horror Story bei reactormag.com (ehemals tor.com). Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Tobias Eberhard.
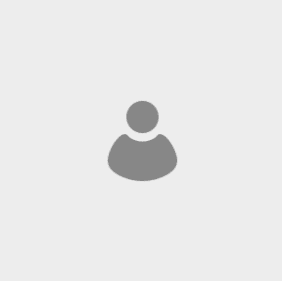
Emily Hughes
Emily Hughes will (mit dir) über unheimliche Bücher reden. Sie war Redakteurin bei Unbound Worlds und TorNightfire.com und schreibt nun einen Newsletter über Horrorliteratur – und haut nebenher schlechte Wortwitze auf Social Media raus. Sie schreibt unter anderem für Vulture, Tor.com, Electric Literature und Thrillist. Sie lebt mit ihrem Ehemann und ihren vier durchgedrehten Katzen im Westen von Massachusetts.







