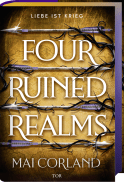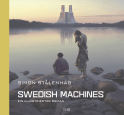Science&Fiction: Tourismus

Uwe Post, 18.09.2025
In lockerer Abfolge erforschen wir an dieser Stelle die Beziehung zwischen Wissenschaft und Science Fiction. Greifen fiktive Werke Erkenntnisse oder Trends aus der Forschung auf? Wenn ja, inwiefern? Und inspiriert die SF womöglich sogar Forschende? Oder gelingt es der Wissenschaft zumindest, durch das Aufgreifen von SF-Narrativen ihre Erkenntnisse besser zu vermitteln – was wohl noch nie so wichtig war wie heute?
Sie fragen sich vielleicht: Tourismus? Was hat das mit Wissenschaft zu tun?
Kennen Sie das Deutsche Institut für Tourismusforschung an der FH Westküste in Heide (Schleswig-Holstein)?
Und die Deutsche Gesellschaft für Tourismuswissenschaft? Oder den Arbeitskreis Tourismusforschung in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DgfG)?
Na also!
Last Minute ins Verderben
Ist bei Ihnen im Urlaub auch schonmal etwas schiefgegangen? Die Koffer im falschen Hotel, der Flug umgeleitet, ein Zimmer mit Aussicht auf die Mülltonnen neben dem Hintereingang? Man kann sich gut vorstellen, dass einige Geschichten von solchen Ereignissen inspiriert wurden. Die Autoren haben sich so sehr auf den wohlverdienten Urlaub gefreut, und dann das! Eine kurze Liste der Horrorferien gefällig?
In Westworld (Spielfilm und Serie) sind die Roboter sind nicht ganz so nett zu den Touristen wie vorgesehen.
In Jurassic Park funktioniert das Inventar nicht innerhalb der Parameter, die sich die etwas blauäugig agierenden Betreiber überlegt haben.
Raumschiff Titanic ist ein interstellarer Vergnügungskreuzer voller Roboter mit diversen Fehlfunktionen, erschienen 1999 auf Deutsch als Adventure-Game von Douglas Adams und als Roman von Terry Jones. Die unglückseligen Fehlfunktionen erinnern frappierend an Systemausfälle eigener Windows-PCs, Internetshops oder ein großes deutsches Verkehrsunternehmen.
Für Reiselustige ohne Raumschiffticket sei Der Seelentourist genannt, ein Roman (1966) von Robert Sheckley, in dem man sich lästiges Kofferschleppen sparen kann, weil lediglich das Bewusstsein in die Ferien (sprich: in eine am Urlaubsziel lebende Person) transferiert wird.
Bleibt die Frage: Wieso tun wir uns eigentlich diese Strapazen an, um vor den Strapazen in Alltag und Beruf zu fliehen? Wer schon einmal seinen kreischenden Nachwuchs quer durch ein Flughafenterminal geschleift hat, bevor das Gate schließt, wird an dieser Stelle womöglich verzweifelt nicken.
Die schönste Zeit des Jahres
Das bereits eingangs genannte Institut für Tourismusforschung untersuchte 2024 die »Effekte von Urlaubsreisen auf Erholung, Gesundheit und Wohlbefinden« . Die Datengrundlage waren diverse wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften. Tatsächlich belegen empirische Studien kurz- und langfristige gesundheitliche Effekte. Diese sind vor allem Stressabbau zu verdanken, außerdem befriedigt Urlaub psychologische Bedürfnisse. So wird beispielsweise die Aufmerksamkeitsfähigkeit verbessert. Da möchte man doch direkt der jüngeren Generation Urlaub vom Smartphone ans Herz legen und auf die wissenschaftliche Grundlage verweisen, schwarz auf weißem Bildschirm.
Das Wohlbefinden steigert sich vor allem mit Lebenszufriedenheit und Sinnfindung, aber auch Quantätit und Qualität des Schlafes. Natürlich erst, wenn der Nachtflug Richtung Urlaubsparadies überstanden ist. Klarer Fall: Urlaub ist gesund! Wieso zum Kuckuck wird er dann nicht von der Krankenkasse bezahlt? Sicher ließen sich Millionen an Arztkosten einsparen! Außer bei Skiurlaub mit Einsatz des Rettungs-Helikopters. Abenteuerurlaub gehört also weiterhin selbst bezahlt.
Die Tourismusforscher empfehlen in ihrem Fazit der deutschen Tourismusbranche, den nachgewiesenen gesamtgesellschaftlichen Nutzen von Urlaubsreisen stärker in den Mittelpunkt zu stellen und somit die gesellschaftliche Relevanz der Branche zu verdeutlichen.
Eingestehen muss die Hochschule jedoch, dass bei zukünftiger Forschung objektive Indikatoren (also beispielsweise Herzfrequenzmessung) hilfreich wären, denn man verlässt sich auf kleine Stichproben ohne Kontrollgruppen (die den Urlaub auf Sofa oder Balkon verbringen) und Studien, die ihre spärlichen Daten hauptsächlich aus Befragungen einer Handvoll Touristen beziehen. Aber vielleicht kann Google ja bei Gelegenheit in seinen Datensilos die Herzfrequenz-Messdaten von Smartwatches daheim und in den Ferien miteinander vergleichen.
Fernweh als Antrieb
Die Gründe für Urlaubsreisen sind natürlich vielfältig. Die Verbesserung der körperlichen Befindlichkeit oder Stressabbau mögen von Bedeutung sein, eine Reise dient aber auch – vor allem im Zusammenwirken mit Ansichtskarten oder dem heutigen Analogon, nämlich Fotos im Whatsapp-Status – dazu, den eigenen sozialen Status zu verdeutlichen: »Schau, ich bin da, wo du noch nie warst.« Oder: »Schau, ich kann mir eine Woche Galapagos leisten und du nicht.«
Letztlich geht es also um eine Art Selbstinszenierung. Ein Lied darüber singen können die Bürgermeister von Urlaubsorten, die alle paar Tage von Kreuzfahrern auf Landgang niedergetrampelt werden, die unbedingt dasselbe Selfie schießen wollen wie irgendwelche Instagram-Influencer. »Schau, an was für einem schönen Ort ich bin!« Nicht verraten wird: »Ich schwitze hier gerade bei 40 Grad und muss das Foto genau im richtigen Winkel und Moment aufnehmen, damit du nicht die tausend anderen Touris siehst, die die ganze Zeit oh my god! krähen«.
Dorthin gehen zu können, wo die anderen nie hinkönnen, war vor dem Einsetzen des Massentourismus ein wichtiger Grund für Reisen. Arbeiter im Industriezeitalter mangelte es schlicht an Geld und (Frei-)Zeit, bis die Moderne Errungenschaften hervorbrachte wie zwanzig Urlaubstage, Reisebüros und Hochglanzkataloge, in denen komischerweise immer die Sonne auf fröhliche Strandschönheiten scheint. Billigflieger machten Reisen in den letzten Jahrzehnten nicht nur massentauglich, sondern auch zu einer Umweltbelastung. An diese zu denken, würde aber der Erholung schaden, die man sich mit monatelanger harter Arbeit redlich verdient hat. Lieber nicht!
Dass die Realität oft anders aussieht und schon mit einer ausfallenden S-Bahn zum Flughafen der Stresspegel auf schädliche Werte steigen kann, ist die Kehrseite der Medaille und, extrapoliert in Zukunft oder Weltraum, Thema lustiger, spannender oder grauenerregender SF-Geschichten.
Quer durchs Weltall
Es wäre arg naheliegend, als Beispiel für Tourismus in der SF eine Serie wie Doctor Who heranzuziehen. Denn reist der Doctor nicht bisweilen mit seinen Begleitern einfach zum Spaß zu einem fernen, exotischen Planeten, um ihn zu besichtigen? Natürlich geht dort umgehend irgendetwas schief oder eine Bedrohung taucht auf. Erzählerisch ist diese Reiselust schlicht und einfach der Notwendigkeit geschuldet, die Protagonisten zu Beginn der Folge an den für die vorgesehene Dramaturgie passenden Ort zu bekommen.
Es sind eher Serien wie Westworld oder Futurama, die sich differenzierter mit dem Thema auseinandersetzen. Sind nicht die Roboter in Westworld genauso Bauernopfer eines Geld scheffelnden Touri-Ausbeuters wie die Hotelangestellten in einem Karibik-Resort?
Und als die Futurama-Besatzung in Episode 10 von Staffel 1 eine Kreuzfahrt auf einem Raumschiff namens Titanic unternimmt (nicht zu verwechseln mit dem von Douglas Adams), reist nur der Chef erste Klasse. Auch im Urlaub müssen Standesunterschiede sichtbar bleiben, wo kämen wir denn sonst hin?
Nicht allzu gut weg kommen die Touristen in Alfred Besters Kurzgeschichte Reisetagebuch (in: Hände weg von Zeitmaschinen, 1978, nur antiquarisch erhältlich). Der unbekannte Autor des Reisetagebuchs freut sich in seinen Urlauben auf Venus, Alpha Centauri oder Andromeda darüber, dass die Leute alle Englisch sprechen und dass er billig einkaufen kann. Nur bei der Zeitreise ins London des 17. Jahrhunderts wird es schwierig, weil die Einheimischen »noch nicht einmal ihr eigenes Englisch richtig sprechen«. SF als Zerrspiegel der Wirklichkeit – schmerzhaft, aber notwendig. Zwischendurch beschwert sich der Tagebuchschreiber übrigens über vermeintlich unverschämte Einheimische, die ihn abzocken wollen.
Ziemlich genau die umgekehrte Perspektive stellt die Episode 2 der Prime-Serie Philip K. Dick’s Electric Dreams dar: Zwei Tour Guides werden von einer 342 Jahre alten Frau gebeten, mit ihr zur guten alten Erde zu reisen – die beiden wissen aber nicht einmal, ob es den Planeten noch gibt und reisen einfach zu einem, der so ähnlich ausschaut. Die zugrunde liegende Kurzgeschichte stammt aus dem Jahr 1953 und ist eines der zahlreichen Beispiele für Dicks Werk, in dem sich oft hinter einer dünnen Schicht aus Wirklichkeit schwierige moralische Fragen verbergen. Was wäre schlimmer? Der alten Frau die enttäuschende Wahrheit sagen oder ihr ein Erlebnis ermöglichen, das ihren Wünschen zumindest nahekommt?
Allzu viele Beispiele für Tourismus als Hauptthema einer SF-Geschichte gibt es tatsächlich nicht. Was wäre das auch für eine Fluchtliteratur, wenn wir im Urlaub am Strand furchtbare Erlebnisse eines Touristen in einem Urlaub am Strand (auf einem fremden Planeten) miterleben müssten? Oder wenn wir uns damit auseinandersetzen müssten, dass es immer Verlierer gibt, auch beim Tourismus? Im Urlaub kommt es uns nur darauf an, dass wir uns beim Buffet den Bauch vollschlagen können, nicht auf das Gehalt oder die Arbeitsbedingungen des Kochs. Bitte nicht mit schlimmen Vibes den wohlverdienten Urlaub verderben! Dann doch lieber bunte Raumschiffschlachten in einem interstellaren Krieg, der mit Sicherheit in keinem Urlaubsprospekt steht. Suchen Sie mal bei einem Onlinedienst Ihrer Wahl nach dem Reiseziel »Ukraine«.
Luxus im Vakuum
Zurück zu Urlaubszielen, die heute für einfache Leute unerreichbar sind und sich daher prima zum Angeben eignen. Was früher für die Seychellen oder die Malediven galt, verlagert sich nicht nur aufgrund der mäßigen Attraktivität sterbender Korallenriffe nach anderswo: in den Orbit.
Urlaub der modernen Art führt nämlich hinauf ins All. Freilich sind die Trips von Blue Origin oder Virgin Galactic nur was für Milliardäre. Aber war nicht auch vor hundert Jahren eine Reise mit dem Orient Express nur den Reichen vorbehalten? Normalverdiener konnten nur mit großen Augen dem Zug hinterher schauen und bekamen das luxuriöse Innere nur im gleichnamigen Spielfilm mit dem belgischen Ermittler Hercules Poirot zu Gesicht.
Vielleicht erhalten Sie eines Tages eine Ansichtskarte vom Mars und schreiben ihn als Reiseziel auf Ihre Bucketlist. Vielleicht schauen Sie aber auch einfach mal zur Erholung im nächsten Wald vorbei oder beobachten abends an einem stillen See, wie sich die Sterne im Wasser spiegeln.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen schönen Urlaub!

Uwe Post
Uwe Post, Jahrgang 1968, ist Software- und Spieleentwickler, IT-Berater sowie Autor von IT-Fachbüchern und SF-Kurzgeschichten und -Romanen. »Walpar Tonnraffir und der Zeigefinger Gottes« wurde 2011 mit dem Deutschen Science Fiction Preis und dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet, zuletzt erschien »Errungenschaft freigeschaltet« in der Edition Übermorgen. Außerdem ist Uwe Post Mitherausgeber des Future Fiction Magazine (Deutsche Ausgabe). Er lebt mit seinen Kindern am südlichen Rand des Ruhrgebiets.
Homepage: https://uwepost.de
Instagram: @upostbot