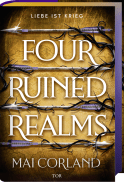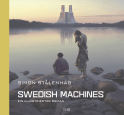Fünf japanische Science-Fiction-Bücher

Markus Mäurer, 04.09.2025
Science-Fiction-Animes und -Mangas dürften den Meisten bekannt sein, doch wie sieht es mit SF-Literatur aus Japan aus? Unser Redakteur Markus Mäurer stellt euch fünf lesenswerte Bücher vor.
Das hier ist eigentlich auch ein trauriger Beitrag, denn obwohl inzwischen relativ viel japanische Literatur ins Deutsche übersetzt wird (vor allem Krimis und Cozy- oder Healing-Fiction), sind nur drei der fünf hier aufgezählten Romane auf Deutsch erschienen. Wenn Science Fiction oder Phantastik allgemein nicht von sehr bekannten Autor*innen wie Haruke Murakami (Hardboiled Wonderland) oder Yoko Ogawa (Insel der verlorenen Erinnerung) stammt, die normalerweise keine SF schreiben, sondern eher allgemeine Belletristik, oder es Verfilmungen gibt, wie z. B. bei Koushun Takamis Battle Royal, dann hat sie es trotz des Japan-Booms schwer.
Dabei hat die japanische Science Fiction eine lange Tradition, die bis in die 1930er zurückreicht. Der hier vorgestellte Roman Die letzte Utopie erschien bereits 1952, also im selben Jahr wie Osamu Tezuka Kult-Manga Astro Boy. Und es sind vor allem Mangas und Anime, an die wir bei japanischer Science Fiction denken, und vielleicht noch die unzähligen Godzilla-Filme, vom ersten Teil an, der 1954 erschien und schon SF-Elemente enthielt.
Aber eine ausführliche Geschichte der japanischen Science-Fiction-Literatur wird hier in einigen Wochen noch erscheinen, in dem Beitrag jetzt möchte ich euch einfach mal fünf japanische SF-Bücher vorstellen, von denen ich glaube, dass sie die große Vielfalt des Genres ganz gut abbilden.
Die letzte Utopie | Tatsuzō Ishikawa (Saigo no kyōwakoku, 1952)
Nach Ende des 2. Weltkriegs lagen Japan und Tokio in Trümmern. Es herrschten Armut, Hunger und Zensur durch die amerikanische Militärverwaltung. Akira Kurosawas Film Drunken Angel schildert ganz gut die damaligen Zustände. Zu Beginn der 1950er ging es schon langsam aufwärts, wie wir auch in den Werken von Yasujirō Ozu (Reise nach Tokyo) sehen können.
Das Buch erinnert vom distanzierten, sachlich wirkenden Sound an die Werke von Autoren wie Isaac Asimov und kommt auch als Sammlung fiktiver Zeitungsberichte daher. Wir finden uns in einer Zukunft wieder, in der menschenähnliche Roboter uns viel Arbeit abnehmen und uns in einer vermeintlich utopischen Gesellschaft leben lassen, in der die Roboter aber auch wie Sklaven arbeiten müssen und immer wieder Aufstände proben, um für ihre Rechte zu kämpfen.
Das Setting der Geschichte ist global angelegt, es geht viel um die Weltregierung, aber es gibt auch ein paar Figuren, die uns durch die Geschichte begleiten. Wissenschaftler, die sich mit Reproduktion beschäftigen und immer kürzere Schwangerschaften versprechen; aber auch eine junge Sängerin aus der russischen Einöde, die sich zu einem Medienphänomen entwickelt.
Das Buch steck voller Kuriositäten, wie z. B. »Loloa: Arznei, die eine Aversion gegen Männergeruch auslöst. (Lesbische Frauen lösen dieses weiß-kristalline Pulver in Getränken auf, damit sie sich nicht in Männer verlieben).«
Dafür, dass Die letzte Utopie schon 1952 in Japan erschienen ist, wirkt der Roman in vielerlei Hinsicht sehr modern, sowohl was technische als auch gesellschaftliche Entwicklungen angeht, allein das Frauenbild des Autors ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin aber erstaunt, wie viel Raum Themen wie Homosexualität, Reproduktion und Sexualität bei ihm einnehmen.
Die Handlung setzt übrigens im Jahr 2025 ein. Und es ist faszinierend zu sehen, wie der Autor sich unsere Gegenwart vorgestellt hat.
Tatsuzō Ishikawa erzählt ein großes Panorama der Menschheit im Zeichen des technologischen Fortschritts und der moralischen und ethischen Fragen, die damit einhergehen. Anders als bei Assimov und Co. wird dieser Fortschritt nicht rein positiv betrachtet, sondern sorgt für gesellschaftliche Verwerfungen, die teils dystopische bis apokalyptische Züge annehmen.
Für heutige Lesegewohnheiten ist das Buch sicher nicht ganz einfach zu lesen, stellt aber ein interessantes Zeitdokument dar, das zeigt, dass Science Fiction in Japan auch schon kurz nach dem 2. Weltkrieg ein Thema war.
Die deutsche Übersetzung stammt von Sabine Mangold und Yuri Mizobuchi.
All You Need is Kill | Hiroshi Sakurazaka (2004)
Kennt ihr den Film Edge of Tomorrow bzw. Live. Die. Repeat mit Tom Cruise, der einen Soldaten spielt, der murmeltiertagmäßig dieselbe Schlacht gegen Aliens immer wieder und wieder erlebt? Das hier ist die Romanvorlage. Eine kurze, knackige Light Novel von knapp 200 Seiten, die aber mehr Tiefgang in Blick auf die Figuren hat, als ich erwartet hatte. Spielte Cruise noch einen älteren Presseoffizier, der in Europa durch eine Intrige in die Schlacht gerät, ist unser Protagonist Keiji Kiriya ein junger Rekrut, der kurz vor seiner ersten Schlacht gegen die käferartigen Mimics steht – in der er natürlich stirbt, und am Tag zuvor wieder aufwacht. Der Film hat viel geändert, aber das Grundkonzept ist das gleiche. So wie Bill Murray in Und täglich grüßt das Murmeltier über viele sich wiederholende Tage Klavierspielen lernt, um Andy McDowell zu beeindrucken, muss Keiji hier lernen, wie er in seinem Jack, einem mechanischen Kampfanzug, gegen die Mimics bestehen kann. Dabei versucht er, der Ursache der Zeitschleife auf den Grund zu gehen.
Der Roman spielt in Japan, die Militäreinheit ist aber eine internationale. Die Rolle, die im Film von Emily Blunt gespielt wird, gibt es hier auch, das ist Rita Vrataski, die Full Metal Bitch, die einen legendären Status als Kämpferin erreicht hat. Mit ihr tut sich Keiji zusammen, um die Zeitschleife zu durchbrechen.
Auf den ersten Blick ist All You Need is Kill ein rasanter Military-SF-Roman mit viel Action, doch durch den Kniff mit der Zeitschleife wird daraus ein cleveres Konstrukt, das uns die Hintergründe der Invasion erklärt, den Figuren mehr Persönlichkeit verleiht und Einblicke in die Struktur des Militärs gewährt. Ein erstaunlich origineller Roman, der mir richtig Spaß gemacht hat.
Ich habe die englische Übersetzung von Joseph Reeder und Alexander O Smith gelesen, die deutsche von Gandalf Bartholomäus ist 2014 bei Tokyo Pop erschienen, das Buch ist inzwischen allerdings vergriffen.
Harmony | Project Ito (Hāmonī, 2008)
Wo fängt der menschliche Wille an? Wo besteht er nur aus neuronalen Prozessen im Gehirn? Was macht das Bewusstsein aus? Und was wären wir ohne? In seinem Science-Fiction-Roman Harmony geht der japanische Schriftsteller Project Itoh den ganz großen Fragen der Menschheit nach.
Nach dem gewalttätigen Zerfall der Gesellschaft, der in einer atomaren Katastrophe und der Auflösung der USA mündete, hat sich die Menschheit vorgenommen: „Nie wieder“ (wie gut das funktioniert, erleben wir ja gerade live). Dazu wurden Nanobots entwickelt, die im menschlichen Körper für eine Regulierung der Gesundheit sorgen. Krankheiten gehören der Vergangenheit an, und selbst der Tod durch Altersschwäche ist in weite Ferne gerückt. Überwacht wird das Ganze durch die sogenannte „Admedistration“ (kein Vertipper), die festlegt, auf welche Weise die Menschen gesund zu leben haben. Ernährt man sich ungesund, meldet der Körper das direkt und man muss zur Therapie. Ungesunde Ernährung, Tabak und Alkohol wurden abgeschafft, ebenso wie die Privatsphäre. Der Körper gehört der Gesellschaft und wer ihn nicht pflegt, schadet ihr. Es herrscht – zumindest auf den ersten Blick – Harmonie.
Doch die Admedistration ist noch nicht in allen Ländern der Erde angekommen, gerade die sogenannten Entwicklungsländer verweigern sich der totalen Überwachung und führen weiterhin Kriege, in denen die Admedistration in Form der WHO kräftig mitmischt. Und für eine Unterorganisation der WHO namens Helix arbeitet unsere Protagonistin und Ich-Erzählerin Turan. Sie treibt sich an der Front rum und genießt die dortigen Freiheiten, Alkohol und Tabak konsumieren zu können, während sie mit Rebellen verhandelt und im Verlauf einer Verschwörung auf die Spur kommt.
Der Roman wird auf zwei Zeitebenen erzählt: die, die in der Roman-Gegenwart mit der obig geschilderten Handlung spielt, und jenen, die von Tuans Schulzeit erzählt. Wo sie ihre Freundinnen Micah und Cian kennenlernt und einen Selbstmordpakt mit ihnen schmiedet. Denn in einer Gesellschaft, in der der eigenen Körper einem nicht mehr selbst gehört, sondern der Gesellschaft, ist der Suizid die ultimative Rebellion. Doch etwas geht schief und alles hängt mit den Ereignissen in der Gegenwart zusammen.
Als Project (Satoshi) Itoh diesen Roman ein letztes Mal überarbeitete, lag er bereits im Krankenhaus, wo er wegen einer Krebserkrankung behandelt wurde, die ihn schließlich 2009 im Alter von nur 34 Jahren das Leben kosten sollte. Seit 2001 war der Krebs immer wieder zurückgekehrt. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Erfahrung die Phantasie eines SF-Autors anregt, mit Gedankenspielen, wie es aussehen könnte, wenn die Menschheit Krankheiten und das Altern mittels technologischen Fortschritts überwunden hat. Und ein kreativer, rebellischer Kopf wie Itoh-San macht es sich dabei sicher nicht so einfach, nur eine utopische, harmonische Gesellschaft zu schildern, sondern denkt auch über die Schattenseiten einer solchen Entwicklung nach.
Englische Übersetzung Alexander O. Smith. Ich hatte mir das Buch 2024 als E-Book gekauft, aktuell scheint es aber leider nicht erhältlich zu sein.
Under the Eye of the Big Bird | Hiromi Kawakami (Ōkina tori ni sarawarenai yō, 2024)
Hiromi Kawakami ist eine sehr vielseitige Autorin, die hauptsächlich im literarischen Bereich schreibt, dem SF-Genre aber nicht abgeneigt ist. In Deutschland dürfte sie vor allem durch ihren Roman Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß (Tokyo Strange Weather) bekannt sein, in dem sich eine einsame Frau mit einem älteren Herrn anfreundet. Mit ihrer Kurzgeschichtensammlung Dragon Palace hat sie aber auch schon hervorragende Weird-Fiction-Geschichten abgeliefert. Mit dem für den International Booker Prize nominierten Mosaik-Roman Under the Eye of the Big Bird wagt sie sich nun an die Science Fiction und meistert sie erstklassig. Im Prinzip ist das ein Episodenroman, bei dem sich erst im Verlauf erschließt, dass alle in der gleichen Welt spielen, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten – aber alle nach der Apokalypse.
Die Menschheit ist fast vernichtet, bis auf einige weit verstreute Siedlungen, in denen die Menschen von sogenannten Müttern großgezogen und angeleitet werden, bei denen ziemlich schnell klar wird, dass sie künstliche Wesen sind. Einige Menschen entwickeln besondere Begabungen, die übernatürlich anmuten, anderer sind als Beobachter unterwegs. Es ist ein größtenteils friedliches Zusammenleben, aber durchaus mit Konfliktpotenzial. Der Stil der Geschichten unterscheidet sich sehr, Kawakami liefert hier eine große Bandbreite ab, die dafür sorgt, dass es trotz thematischer Überschneidungen nie langweilig wird. Das Ganze ist ein großes Puzzle, das am Ende zwar ausführlich erklärt wird, uns vorher aber dem Spaß überlässt, mitzurätseln und über die Lücken zu spekulieren. Stilistisch hervorragend geschrieben und übersetzt, erhalten wir einen poetischen, melancholischen Blick auf die letzten Jahrhunderte der Menschheit.
Eine deutsche Ausgabe ist bisher nicht erschienen, ich habe die englische Übersetzung von Asa Yoneda gelesen.
Tokyo Sympathy Tower | Rie Qudan (Tōkyō-to Dōjō Tō, 2025)
„Japan in der nahen Zukunft“, heißt es im Klappentext. Damit das so bleibt, müsst ihr euch mit dem Lesen aber beeilen, denn die nahe Zukunft setzt bereits 2026 ein und erstreckt sich bis 2030. Ob diese Novelle wirklich Science Fiction ist, darüber lässt sich streiten. Eine wirkliche Handlung wird nicht erzählt. Wir lernen die japanische Architektin Sara Makina kennen, die in einem Hotelzimmer über einen Entwurf für eine Ausschreibung nachdenkt, dabei aber immer wieder abschweift und ganz viele Themen anspricht. Im Prinzip geht es aber um den titelgebenden Tokyo Sympathy Tower, der neben dem Olympiastadion ein neues architektonisches Highlight im Stadtpanorama darstellen und gleichzeitig als modernes Gefängnis dienen soll.
Und so geht es auch darum, wie die Gesellschaft in Zukunft mit Kriminalität und Kriminellen umgehen könnte. Dazu sollte erwähnt werden, dass Japan ein sehr strenges und überholtes Justizsystem hat, das sich noch immer am preußischen Modell orientiert und von Amnesty International regelmäßig der Folter bezichtigt wird. Allerdings wurde vor wenigen Wochen tatsächlich eine Justizreform bekanntgegeben. Somit ist die Novelle von Rie Quodan hochaktuell, aber eben keine spannende Geschichte. Eher eine literarische Reflexion über die Gesellschaft, die Bedeutung von Worten in ihr und die Stellung der Frau, in der zahlreiche Themen angerissen, aber oft nicht vertieft werden.
Für Aufregung sorgte der Roman, als bekannt wurde, dass Qudan ChatGPT beim Verfassen zur Hilfe genommen hat. Das gilt allerdings nur für die Zwiegespräche, die die Protagonistin mit einer Chat-KI führt, was ungefähr fünf Prozent des Buches ausmacht. Hier wollte sie wohl besonders authentisch sein, ich hätte mir aber gewünscht, dass sich eine so talentierte Autorin lieber selbst pointierte KI-Dialoge überlegt.
Die deutsche Übersetzung stammt von Ursula Gräfe.
Wie oben schon erwähnt, so wirklich viel an japanischer SF ist auf Deutsch nicht erschienen. Da lohnt sich ein Blick auf den englischsprachigen Buchmarkt. Was ich allerdings überhaupt nicht in Übersetzung habe finden können, ist Space Opera bzw. SF-Literatur, die im Weltraum spielt.

Markus Mäurer
Der ehemalige Sozialpädagoge und Absolvent der Nord- und Lateinamerikastudien an der FU Berlin, der seit seiner Kindheit zwischen hohen Bücherstapeln vergraben den Kopf in fremde Welten steckt, verfasst seit über zehn Jahren Rezensionen für Fantasyguide.de, ist ebenso lange im Science-Fiction- und Fantasy-Fandom unterwegs (Nickname: Pogopuschel), arbeitet seit einigen Jahren als Übersetzer phantastischer Literatur und ist auf Tor Online für das Content Management und die Redaktion verantwortlich.