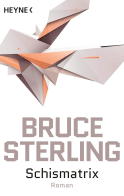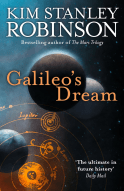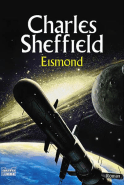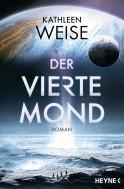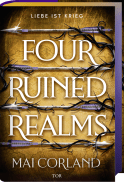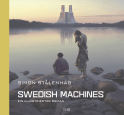Ein "Mars" des 21. Jahrhunderts – Der Jupitermond Europa in der Science Fiction

Christopher Dröge, 11.09. 2025
Europa, einer der vier größten Monde des Jupiters, und der Ozean, der unter seiner Oberfläche vermutet wird, sind für die Wissenschaft schon lange von besonderem Interesse – lang genug, dass zahlreiche SF-Autoren die Idee inzwischen aufgegriffen haben.
Die Frage, ob außerirdisches Leben existiert, ist ein Thema, in dem sich Science und Science Fiction noch mit am weitesten überschneiden. Erst einige Wochen ist es her, da schaffte es eine Entdeckung aus diesem Forschungsbereich bis in den Newsfeed der Tagesschau: Ein internationales Forscherteam hatte in der Atmosphäre des 124 Lichtjahre entfernten Exoplaneten K2-18b Hinweise auf zwei Schwefelverbindungen gefunden, die zumindest auf der Erde ausschließlich von Lebewesen produziert werden. Auch wenn das nicht für andere Planeten stimmen muss, ist K2-18b dennoch aktuell das vielversprechendste Forschungsobjekt, anhand dessen der Beweis für die Existenz von Leben außerhalb der irdischen Biosphäre gelingen könnte.
Nachrichten wie diese beflügeln die Fantasie, aber angesichts der Entfernung von 124 Lichtjahren ahnt der geneigte Leser bereits, dass zu seinen Lebzeiten wohl eher keine Hochglanz-Doku über K2-18b's Fauna und Flora auf Netflix zu sehen sein wird. Vielleicht muss der Blick aber auch gar nicht so weit in die Ferne schweifen, vielleicht werden wir ja auch in unserem eigenen Hinterhof fündig, sprich, unserem Sonnensystem – und das vielleicht schon in einigen Jahren: Denn im Oktober des vergangenen Jahres startete die Europa Clipper Mission der NASA, die den Jupitermond Europa mit einer Raumsonde aus dem Orbit heraus genau unter die Lupe nehmen soll.
Nach Europa, einem Eismond, lecken sich Astrobiologen und solche, die es gerne werden/sein wollen, schon lange die Finger. Interessant für die Fahndung nach außerirdischen Organismen wird er durch sein spannendstes Feature: Forscher vermuten unter seiner Eiskruste einen globalen Ozean aus flüssigem Salzwasser – aufgeheizt von den Gezeitenkräften des Jupiters, die den Satelliten auf seiner Umlaufbahn konstant dehnen und wieder zusammenstauchen. Schon bald nach dieser Hypothese kamen Spekulationen auf, dass der Ozean die notwendigen Bedingungen für die Entstehung von Leben bieten könnte, etwa dank hydrothermaler Quellen am Ozeanboden, die die Energie für ein vom Sonnenlicht abgeschottetes Ökosystem liefern könnten. Wenn es bislang auch keine direkten Hinweise auf günstige Lebensbedingungen unter Europas Eis gibt (oder gar für die tatsächliche Existenz von Leben), konnte die NASA-Sonde Galileo in den 1990er Jahren immerhin die Hinweise auf einen Ozean unter seiner Oberfläche weiter untermauern.
Europa in der Science Fiction
Die Idee von einem außerirdischen Meer in unserer kosmischen Nachbarschaft, in dem alles Mögliche hausen könnte, ist natürlich viel zu faszinierend, als dass sie noch nicht in der Popkultur angekommen ist. Ein prominentes Beispiel ist der Film "Europa Report" von 2013, der eine bemannte Mission zu dem Jupitermond schickt, aber auch viele namhafte SF-Autoren haben diese Steilvorlage seit den 1980er Jahren dankbar aufgegriffen. Tatsächlich tritt Europa als Schauplatz schon viel früher in Erscheinung, etwa in der Erzählung "Redemption Cairn" von dem Pulp-Autoren Stanley G. Weinbaum, erschienen 1936. Damals war von einem subglazialen Ozean noch keine Rede, Weinbaum beschreibt den Jupitermond als felsige Welt, auf der sich der auf der dem Jupiter zugewandten Seite eine dünne Atmosphäre gebildet hat, dank der sich in den Tälern erdähnliche Landschaften ausbreiten.
Diese Version von Europa erschien zu Weinbaums Zeiten noch denkbar, da der Mond durch das Teleskop bis dato nur als leuchtender Fleck zu erkennen gewesen war und höchstens durch seine Helligkeit herausgestochen hatte. Erst mit den Voyager-Sonden Ende der 1970er gelangen scharfe Bilder von der eisigen Oberfläche, die kaum von Einschlagkratern gezeichnet ist – eines der Merkmale, die vermuten lassen, dass die Oberfläche geologisch jung ist und durch ein flüssiges Inneres in ständiger Veränderung begriffen ist.
Die Vorstellung von einem potentiell lebensfreundlichen Ozean unter Europas Eis kam 1979 erstmals auf und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis das Motiv literarisch aufgegriffen wurde, von niemand geringerem als Arthur C. Clarke. Der hatte ein Jahrzehnt zuvor seinen Roman "2001 - Odyssee im Weltraum" geschrieben, praktisch im Tandem mit Stanley Kubrick, der zeitgleich an der Filmversion arbeitete (beide Werke beruhen auf Clarkes eigener Kurzgeschichte "The Sentinel"). Einer der Unterschiede zwischen Roman- und Filmversion besteht darin, dass die Spur des schwarzen Monolithen, der der Evolution des Menschen einen Boost verpasst, im Roman zum Saturn führt, im Film jedoch zum Jupiter. In der 1982 erschienenen Fortsetzung "2010", folgte Clarke dann aber der Filmversion und schickte die Rettungsmission, die dem Verbleib der Discovery One auf den Grund gehen soll, ebenfalls in Richtung Jupiter.
Offensichtlich hatte ihn die Erkenntnisse über Europa inspiriert, denn der Jupitermond spielt am Ende der Erzählung eine Schlüsselrolle: Nachdem die mysteriöse außerirdische Zivilisation, die durch die schwarzen Monolithen repräsentiert wird, den Jupiter in eine Mini-Sonne verwandelt hat, stellt sie dessen dadurch bewohnbar gewordene Monde den Menschen huldvoll zur Besiedelung zur Verfügung – allerdings nicht Europa, der soll tabu bleiben. Der Grund wird im Epilog klar, der 20 000 Jahre später spielt: Nachdem das Eis des Mondes geschmolzen ist, haben die Ureinwohner der Ozeanwelt eine eigene Zivilisation entwickelt.
Clarke war somit wohl der erste Autor, der die Idee von einheimischen Leben auf dem Jupitermond literarisch verarbeitete und diese in seinen weiteren Fortsetzungen "2061" und "3001" zu einem wiederkehrenden Motiv des Zyklus machte. Drei Jahre nach "2010" wiederum erschien Bruce Sterlings Cyberpunk-Space Opera "Schismatrix", in der Europa und sein Ozean ebenfalls auftauchen – hier allerdings nicht dank einer einheimischen Spezies, sondern als gelobtes Land eines posthumanistischen Besiedlungsprojekts, dessen Pioniere die eigenen Körper umformen und eine aquatische Form annehmen, um in der exotischen Umgebung von Europas Ozean leben zu können.
Ein anderer Autor, der sich von der Idee fasziniert zeigt und diese mehrfach aufgreift, ist Kim Stanley Robinson: In "Galileo's Dream" von 2009 lässt er Galileo Galilei, der die vier größten Jupitermonde – neben Europa sind dies Io, Kallisto und Ganymed - einst entdeckt hatte, von Zeitreisenden in die ferne Zukunft des 32. Jahrhunderts versetzen, in der die galileiischen Monde von einer hochentwickelten menschlichen Zivilisation besiedelt sind. Galilei wird in einen Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen hineingezogen, die darüber streiten, ob sie Kontakt zu einer mysteriösen Intelligenz aufnehmen sollen, die den Ozean unter dem Eis bewohnt. Die Gegner fürchten, dass der Kontakt mit einer überlegenen Intelligenz die Menschheit in eine existenzielle Krise stürzen könnte. In diesem Szenario klingt durchaus das Potential für kosmischen Horror an, das dem Konzept innewohnt – was hätte Lovecraft wohl daraus gemacht, hätte er gewusst, dass da draußen ein eisiger Mond seine Bahn zieht, auf dem es einen unterirdischen, lichtlosen Ozean gibt - ein Abgrund, zehn Mal tiefer als der Marianengraben? Robinson allerdings, ökologisch denkender Optimist der er ist, hat mit der Furcht vor den, äh, dem Fremden nichts am Hut, bei ihm erweisen sich die Menschen für die europäische (oder europanische?) Intelligenz als die größere Gefahr. Als er in "2312" von 2013 erneut eine das Sonnensystem umspannende Zivilisation beschreibt, hat sich diese denn auch, anders als in Clarkes "2010", selbst das Tabu auferlegt, den Ozean unter Europa unangetastet zu lassen – denn das Ökosystem, das sie dort vorgefunden haben, soll sich ungestört entwickeln können.
Charles Sheffield hat keine derartigen Berührungsängste: In seinem Roman "Cold As Ice" von 1992 bohrt sich die Menschheit unter die Eisbarriere und erkundet den potentiellen neuen Lebensraum, wobei die einen in den dunklen Tiefen nach einheimischem Leben suchen, während die anderen auch diese Welt vor allem kommerziell nutzen und ausbeuten wollen. In Alastair Reynolds Kurzgeschichte "A Spy in Europa" ist der Jupitermond ebenfalls besiedelt – hier leben Menschen in unterseeischen Städten, die aus der Unterseite des Eismantels in den Ozean hineinragen. Zwar gibt es eine einheimische Fauna, eine größere Rolle aber spielen spielen gentechnisch an den fremden Lebensraum angepasste Fischmenschen.
Mit Kathleen Weise hat sich auch eine deutschsprachige Autorin von Europa inspirieren lassen: In "Der vierte Mond", erschienen 2021, ist zwar nicht Europa Schauplatz der Geschichte, sondern der Nachbarmond Kallisto, dafür spielt Europas Wasser eine nicht unwesentliche Rolle – nämlich in Form von Eiswürfeln für alkoholische Drinks, die bei der Oberschicht zwar schwer in Mode sind, allerdings aufgrund ihres mikrobiellen Gehalts ungeahnte Nebenwirkungen haben.
Auch in anderen Medien haben Autoren Europas Möglichkeiten ausgelotet, so etwa Warren Ellis in seiner Comic-Reihe "Ocean", oder das Video Game "Barotrauma", in dem der Spieler Europas Ozean selbst per U-Boot erkunden kann. Dem bereits erwähnten "Europa Report" kommt schließlich die Ehre zu, erstmalig einen "Europäer" (bzw. "Europaner"?) im Film bildlich darzustellen.
Mittlerweile haben Wissenschaftler bei einer ganzen Reihe weiterer Eismonde im Sonnensystem Hinweise gefunden, dass diese wie Europa unter ihren festen Oberflächen über Ozeane verfügen könnten - der Saturnmond Enceladus gilt inzwischen sogar als der noch heißere Kandidat für einheimisches Leben, da in den Geysiren an seinem Südpol bereits organische Verbindungen gefunden wurden. Doch ein wirklicher Beweis steht noch aus – und bis auf weiteres wird das Innere von Europa und den übrigen Eismonden neugierigen Blicken verschlossen bleiben, denn jegliche Überlegungen, Sonden dorthin zu schicken, die sich durch den Eispanzer schmelzen könnten, sind noch Zukunftsmusik. Doch gerade diese Ungewissheit macht Europa zum idealen Nährboden, auf dem die Fantasie allerlei Blüten treiben kann - so wie es der Mars im 19. Jahrhundert war, als man aufgrund der weniger leistungsstarken Teleskope auf dessen Oberfläche Kanäle zu erkennen glaubte und deswegen für Jahrzehnte überzeugt war, unser Nachbarplanet sei von einer Zivilisation bewohnt. In gut achteinhalb Jahren soll der Europa Clipper sein Ziel erreichen – bis dahin lässt sich noch viel darüber zusammenspinnen, was dort zu finden sein könnte.
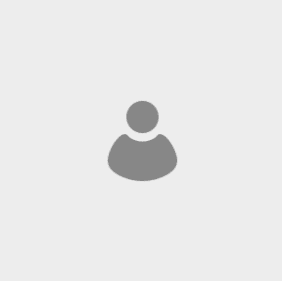
Christopher Dröge
Christopher Dröge, freier Journalist, lebt in Köln und schreibt für verschiedene lokale Tageszeitungen, Stadt- und Kulturmagazine. Seit früher Jugend pflegt er seine Leidenschaft für phantastische Literatur in all ihren Spielarten und hat auch selbst schon die ein oder andere Kurzgeschichte veröffentlicht.